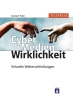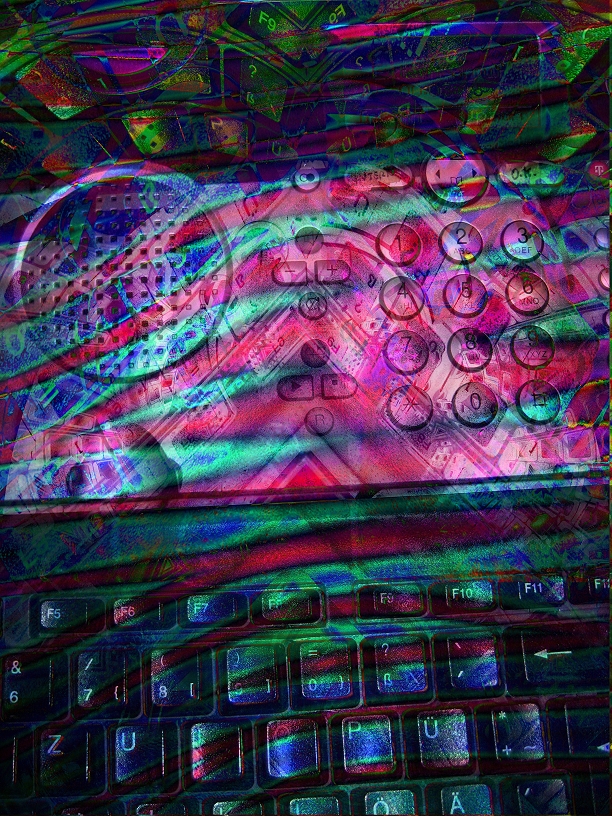|
|
Begegnungen mit einer unheimlichen Sphäre
|
Von der Imagination zur Virtualität "Wozu nützt denn die ganze Erdichtung? - Ich will es dir sagen, Leser, sagst du mir, wozu die Wirklichkeit nützt" provoziert uns Schiller in den Xenien (Nr. 722). Selbstverständlich können wir, befangen in dieser Wirklichkeit, darauf nicht zureichend antworten, weil die Wirklichkeit uns ihren Nutzen weder mitteilt noch gar ersichtlich wäre, dass sie überhaupt einen besitzt. Schiller zweifelt selbstverständlich nicht am Nutzen von Dichtung und Wirklichkeit, weil beide in einem korresponsiven Verhältnis stehen, sich aneinander abarbeiten, um den Begriff von Wirklichkeit vom planen Anschein der Gegenstände zu befreien und zu einer höheren Wirklichkeit sittlicher Vernunft vorzudringen. So soll erst in der Poesie (Schöpfung) die höhere Wirklichkeit jenseits ihres schnöden Scheins entstehen. Dass die Wirklichkeit vom Dichter nachgeschöpft werden muss, um zu ihrem Wesen zu gelangen, ist bei näherem Zusehen eine eigenartige Kondition. Sollte diese Wirklichkeit so paradox sein, dass erst der Dichter in seiner poetischen Rekonstruktion ihr zur "wirklichen Wirklichkeit" verhilft? Oder fällt die Dichtung hinter die Wirklichkeit zurück, revirtualisiert unzulänglich in einem Reich der Ideen, was längst unhintergehbare Form geworden ist? Das Paradox wird entschärft mit dem Wissen, dass jede Wirklichkeit die Summe der Tatsachen ist, die nicht nur im menschlichen Bewusstsein entstehen, sondern auch interpretiert werden müssen, um eine Wahrnehmung dieser Wirklichkeit zu eröffnen Wirklichkeit und dichterische (Nach)Schöpfung stehen so seit Anbeginn ihres mimetischen Verhältnisses in einer produktiven Spannung. Dichtung konnte sich als Medium der Welterschliessung gegen die Anmutungen der Vernunft aber nicht ohne weiteres behaupten. Dichtung zielt zwar auf Wirklichkeit, wird aber im Zuge ihrer Wirkungsgeschichte mit einer anderen Wirklichkeit konfrontiert, die das Imaginäre als anrüchige Kategorie jenseits der Vernunft behandelt. Paul Valéry warnte zudem: "Mit zunehmender Annäherung an das Reale verliert man das Wort" (Cahiers 1, Frankfurt/M, 1987, S. 482). Sollten Dichter das Licht scheuen, obwohl doch das "sentimentalische Genie" die Wirklichkeit verlässt, um zu Ideen aufzusteigen (Schiller in seiner Unterscheidung naiver und sentimentalischer Dichtung)? Das Imaginäre geriet als voraufklärerisches Moment, als Relikt der Vermischung von Innen- und Außenwelt in Verruf, obwohl immerhin Kant die Einbildungskraft zur "reinen Form aller möglichen Erkenntnis" nobilitiert hatte. Heidegger verwies allerdings darauf, dass die zweite Auflage der Kritik der reinen Vernunft sich letztlich für den reinen Verstand gegen die reine Einbildungskraft entschieden habe, um die Vorherrschaft der Vernunft nicht zu gefährden. Die Vernunft sollte sich des schlechten Imaginären entschlagen, sollte die Welt entzaubern, um zu einer Wirklichkeit jenseits der delirierenden Einfälle einer rauschenden Einbildungskraft vorzudringen. Das hat Dichter nicht daran gehindert, ihre Imaginationen weiterhin als ein Element der Wirklichkeit und notwendige Quelle der Bewusstseinstätigkeit auszugeben, weil anderenfalls diese Wirklichkeit nur unzulänglich als rationalistische Reduktion gedeutet würde. Von der dichterischen Lobpreisung der Schöpfung bis zur reinen Poesie beobachten wir eine Konkurrenz von Wirklichkeitsbegriffen, die Dichter immer wieder in ihrer Wirklichkeitskonstruktion glaubten, für sich entscheiden zu können. Der Dichter ergänzt das "esse est percipi" um eine unhintergehbare Form, um eine poetische Apperzeption, die erst der Unordnung der Dinge oder ihrer rationalistischen Verkürzung einen endgültigen Sinn geben soll. Das von der Vernunft verdrängte Imaginäre betritt so immer wieder mit Macht und in neuen Verwandlungen die Szene und behauptet, die Wirklichkeit jenseits eines unreflektierten Realismus zu schöpfen. Erst die Imagination überforme die Dinge in der Wirklichkeit des Bewusstseins, weil allein in der Poesie "logos" und "mythos" eine untrennbare, wenn auch zuletzt spannungsfreie Allianz eingehen. Imagination und Vernunft sind in der Dichtung daher keine diskreten Größen, sondern gehen ein kollusives Spiel ein, um die Wirklichkeit als das virtuelle Spannungsfeld vorzuführen, das sich nicht in vernünftiger Rekonstruktion erschöpft. Immerhin setzt auch die dichterische Produktion eine mediale, im engeren Sinne: metrische und formale, Vernunft voraus, um der Fantasie eine nachvollziehbare Gestalt zu geben. Umfasst die Wirklichkeit somit in der dichterischen (Re)Konstruktion jedes Weltverhältnis, das wir uns vorstellen können, scheitert hier bereits der Versuch, eine alte Unterscheidung zu ziehen: das Wirkliche diskret oder kategorial vom Unwirklichen zu trennen. Auch das Unwirkliche ist in der Wirklichkeit des Bewusstseins zumindest eine logische Größe, um überhaupt Unterscheidungen in der Wirklichkeit treffen zu können. Zwar kann man Imaginationen, Fiktionen, Träume dem Unwirklichen zurechnen, aber in der einzig zugänglichen Wirklichkeit, der Wirklichkeit des Bewusstseins, sind alle diese Zustände schlecht sortiert und dem vermeintlich Unwirklichen kann eine realere Präsenz erwachsen als den vermeintlich wirklichen Gegenständen der Außenwelt. Sehern, Visionären, Träumern, mit einem Wort: Dichtern, gehört das zur Grundausstattung ihrer Wirklichkeitserschließung. Spätestens mit der Psychoanalyse wird dieses alte poetische Wissen bestätigt, dass die Wirklichkeit des Subjekts mindestens in eben so großem Maße von Fantasmen, Träumen, unheimlichen Sensationen des Körpers etc. geprägt ist wie von angeblich gesicherten Außenwahrnehmungen. Freilich wären hier das schlechte Imaginäre, die irrationalen Fantasmen von Imaginationen zu unterschieden, die einer begrenzten Vernunft auf die Sprünge zu einer besseren Wirklichkeit helfen. Die ganze Entwertungs- und Rehabilitationsgeschichte der Einbildungskraft wird von dem roten Faden durchzogen, Vernunft und Fantasie in eins zu setzen, etwa zu einer "visio intellectualis" (Leopold Ziegler) aufzuschließen, die nicht die menschliche Fähigkeit unterschlägt, auch virtuelle Räume zu beherrschen. 1968 forderten Studenten in der Nachfolge Novalis gar, dass die "Fantasie an die Macht" kommen solle. Diese Provokation beinhaltete zwar keine Aussage, an welche Macht denn die Fantasie kommen solle und ob nicht die Fantasie ohnehin eine bereits bestehende Macht sei. Gleichwohl wurde die Formel als Aufruf verstanden, die virtuellen Potenzen des Imaginären neu zu begreifen. Gerade die historisch verfemte Fantasie sollte die eindimensionale, verhärtete Wirklichkeitskonstruktion der Bürger durchbrechen und ein Reich schöpferischer Freiheit einleiten, dessen Vision den eindimensionalen Verhältnissen funktionaler resp. instrumenteller Vernunft geopfert worden war. Hier knüpft der spätmoderne Sturm auf die Bastionen an das alte Wissen des Dichters an, der so selbstherrlich die Schöpfung nachschöpfen, ihren virtuellen Sinn gegen die Fixierungen des Alltagsbewusstseins vermitteln wollte. Aber alle diese Konstruktionen der Alt- und Neustürmer bleiben den Zeichen verhaftet, die dieser Wirklichkeit entliehen sind. Dichter leiden daher a priori nicht nur subjektiv an einer narzisstischen Kränkung, sondern auch objektiv an einem Mangel an Instrumenten, diese Wirklichkeit fundamental neu zu gestalten, weil ihre virtuelle Welterschließung nur aus Zeichen besteht. Bekanntlich widmete sich kein geringer Teil des gesellschaftskritischen Diskurses der 70er-Jahre der Frage künstlerischer, im engeren Sinne poetischer Wirkungsmacht, die regelmäßig hinter ihren politischen Ansprüchen zurückblieb. "Und die Praxis in der Wörterküche der Poesie ließ mich klar erkennen, dass uns Kombinationen von Wörtern deshalb möglich sind, weil sie keine – Dinge sind" konstatiert Paul Valéry (Cahiers 1, Frankfurt/M, 1987, S. 223). So verleiht die poetische "ars combinatoria" zwar Macht im Reich der Sprache, aber der Dichter vermag keine neue Ordnung der Gegenstände jenseits dieser Zeichen zu konstituieren. In den vormals so gefestigten Glauben an die Demiurgenkunst der Poeten drängte sich im Laufe ihrer Applikation immer stärker der Zweifel, der Wirklichkeit in der Virtualität der Zeichen je beikommen zu können. Unter dem Gewicht dieses Zweifels vollzieht sich spätestens im 19.Jahrhundert eine kopernikanische Wende, nicht länger dichterischen oder philosophischen Wesensschauen zu vertrauen, die hinter den Oberflächen Wirklichkeit wie eine kostbare Essenz zu Tage fördern, sondern die Oberflächen selbst als das offenste Geheimnis dieser Wirklichkeit zu begreifen. Von den Hinterwelten des unergründlichen Seins, in dem wir auch nach existenzialistischen Fundamentalentwürfen keine Heimat gefunden haben, sind wir darum spätestens seit Nietzsche zum Lob der Oberflächen vorgedrungen. Der Schein schiebt sich, wie es die neuzeitliche Orthodoxie will, als das Realere vor das unergründliche Sein der Dinge. Die Maja mag ihren Schleier behalten, so lange die Wirklichkeit sich unserem Willen unterwerfen lässt. Aber auch wenn einige dieser Oberflächen konstruierbar und manipulierbar sind, stoßen wir immer wieder auf Objekte (Widerstände – Gegenstände), die sich diesem Willen nicht beugen, uns an ihren Fassaden abprallen lassen. Und so wird hinter der Politik der Fassaden, der mächtigen Kosmetik der Dinge, die so oder anders sein können, die alte platonische Spannung zwischen Sein und Schein wach gehalten, auch wenn wir vorübergehend oder endgültig den Glauben verloren haben, dieses idealische Sein als unfreiwillige "Höhlenbewohner" je begreifen zu können. Das Lob der Oberflächen ist aber vielmehr als das Ressentiment gegen das nichteinlösbare platonische Programm der Ideenschau. Hier leitet sich ein politisches Programm ein, diese Wirklichkeit zu gestalten, ohne das Wesen dieser Welt deshalb verstehen zu müssen. Selbst in der Philosophie kann jetzt Marx das hegelianische Erkenntnisprogramm des absoluten Wissens auf den Kopf (bzw. auf die Füße – je nach Beobachterstandpunkt) stellen und damit provozieren, dass es nicht darauf ankomme, die Welt zu verstehen, sondern sie zu verändern. Veränderung setzt zwar Verstehen voraus, aber es handelt sich um eine andere Art von Verstehen: Wir dringen in das Gefüge der Wirklichkeit ein, um ihre Veränderlichkeit (natur)wissenschaftlich zu begreifen, um sie auf schnellstem Weg von ihrer Naturwüchsigkeit zu befreien und ihr eine menschliche Form zu verleihen. Ihr göttlicher Ursprung und ihre Essenz mögen Stoff der Imagination bleiben, werden aber als Erkenntnisgegenstände suspendiert. Jean Pauls programmatisches Wort "Die Poesie schildert die beste Welt, die vor der Schöpfung in Gott war" (Ideen-Gewimmel, Frankfurt/M 1996, S. 63) wird nun gegen das Programm ausgetauscht, die beste Welt nach einer unvordenklichen "Schöpfung" im Menschenmaßstab herzustellen. Mit einer positivistischen Forschung und in der Omnipotenz der Industrialisierung wird dieses Programm der Wirklichkeitsgestaltung zum ersten Mal in der Geschichte wirkungsmächtig genug, um das zuvor unreflektierte Machen oder die bloße Schilderung bester Welten hinter sich zu lassen. Die Welt ist ab jetzt alles, was wir verändern können, indem wir unsere Instrumente verbessern, unsere Sinnesorgane medial aufrüsten und neue Explorationstechniken entwickeln. Mit anderen Worten: Wir realisieren die Welt neu, indem wir sie virtualisieren, in einen Zustand der Manipulierbarkeit versetzen, die nicht vergeblich nach dem Sinn der Wirklichkeit fragt, sondern nach ihrem Nutzen. Zwar hat auch die kopernikanische Wendung vom Verstehen der Wirklichkeit, der Wechsel von der Lektüre im Buch der Natur zur radikalen Veränderung einer in dieser Weise nicht annehmbaren Wirklichkeit, die Hoffnung nicht besiegt, hinter den Fassaden der Wahrnehmung eine Weltformel dieser Wirklichkeit zu finden, die absolutes Wissen verheißt. Aber diese Suche, nichts anderes als die reformulierte Suche nach dem "Ding an sich", kann warten, solange die Vorstöße in andere Wirklichkeiten, die vielleicht weniger widerständig auf existenzielle Fragen reagieren, noch Erfolg versprechend sind. Immerhin haben wir Schillers Frage nach dem Nutzen der Wirklichkeit vorläufig beantwortet: Er besteht in dem neuem Anspruch, diese Wirklichkeit nicht hinzunehmen, sich lediglich in ihr einzurichten, sondern sie als plastischen Stoff zu realisieren, um neue oder andere Wirklichkeiten herzustellen, d.h. zu virtualisieren. "Wir sind auf einer Mission: zur Bildung der Erde sind wir berufen" wie Novalis gläubig verkündet (Blüthenstaub, Bemerkung Nr. 32). Freilich sind die Übergänge zwischen Einrichtung in der Wirklichkeit und ihrer Veränderung zunächst noch so fließend, dass der Preis der neuen Wirklichkeitskonstruktion im Verlust einer gefestigten Wirklichkeit besteht. So folgt notwendig auf die "Entzauberung der Welt durch Wissenschaft" (Max Weber) die noch schmerzlichere "Agonie des Realen" (Jean Baudrillard). Lässt sich die Wirklichkeit nicht mehr als eine geschlossene Sphäre konstituieren, weil sie manipulierbar ist, hat es auch keinen Sinn mehr, das Reale als gesicherte Kategorie noch länger zu behaupten. Gleichzeitig lässt sich die Verlustgeschichte der Wirklichkeit als Zuständigkeitswechsel beschreiben, in dem die imaginären Momente der Poesie gegen die virtuellen Momente technologischer Herrschaft ausgetauscht werden. Virtualität gilt danach nicht als Bewusstseins- und Erkenntnismodus, sondern als die nachhaltigste Form der Wirklichkeitskonstruktion, die je zum Arsenal menschlicher Gestaltungsfähigkeit gehörte. So hatte die Virtualität in den Imaginationen der Dichter und den philosophischen Spekulationen ihre symbolische Vorform gefunden, die nun von einer Technologie tausendfach überboten werden kann. In dieser Virtualität beginnt die Technologie von einer Realität zu träumen, aber dieser Traum will sich selbst in härtester Wirklichkeit bewähren: Die technologische Virtualität wird zur Fortsetzung der imaginären Virtualität mit anderen, d.h. besseren Mitteln. Das technologisch formulierte Virtualitätsparadigma der Welterschließung vollendet sich ab jetzt in der Projektion und Realisation von Welten, die virtuell generiert sind, aber nicht hinter ihrer Ausgangswirklichkeit zurückstehen sollen. Ihre avancierteste Form hat diese Virtualität gegenwärtig in ihrer digitalen Form gefunden. In der digitalen Virtualität erwächst der Wirklichkeit eine Konkurrenz, die unseren ohnehin höchst unvollkommenen Begriff von Wirklichkeit stärker provoziert, als es je den Imaginationen der Dichtung oder den Spekulationen der Philosophie möglich war. Zwar gehören die Modalkategorien "Möglichkeit" und "Wirklichkeit" seit ihrem Aufkommen in der aristotelischen Metaphysik ("dynamis" und "energeia") und ihrer Variation als "potentia" und "actus" in der Philosophie des Mittelalters bis hin zu Leibniz zum festen Begriffsinventar einer sich orientierenden Vernunft (Nicolai Hartmann, Die Erkenntnis im Lichte der Ontologie, Hamburg 1982, S. 45 f.). Aber mit dem Siegeszug der neuen Physik reduzierte sich diese Begrifflichkeit in der Forderung nach vollständigen Kausalbeziehungen darauf, festzustellen, dass das, was möglich ist, nur das ist, was auch wirklich ist. Allein im Gegensatz von ontologischen und logischen Modi wird weiterhin deutlich, dass sich die reale Welt von der Welt der Gedanken unterscheidet. Diese Differenz reicht aber als Folie des Verhältnisses von Realität und Virtualität schon deshalb nicht zum Verstehen aus, weil sich der digitale Cyberspace nicht der logischen Sphäre zuschlagen lässt, sondern – unheimlich genug – einen wenn auch zunächst noch unvollkommenen Realitätsstatus reklamiert. An Stelle des hoffnungslosen Versuchs, ontologische Aussagen zum Verhältnis dieser Begrifflichkeiten zu machen, gilt es jetzt, Wirklichkeits- und Virtualitätserfahrungen zu vergleichen – in der phänomenologischen Hoffnung, unseren Aufenthalt in beiden Welten, ihre Interpretationen, Wechselverhältnisse und Synthesen ein wenig besser zu verstehen. Phänomenologisch können etwa Online-Erfahrungen nicht auf die vorgängigen Erfahrungen unserer Ausgangswelt plan zurückgeführt werden, weil die Raum- und Zeitmodi, die Bewegungstypen, die Subjektkonstitution und viele Folgephänomene anderen Regeln folgen. Nicht das geringste Problem ist dabei die semantische resp. metaphorische Übertragung klassischer Erfahrungsweisen auf digitale. Im Konnektivitätsideal der digitalen Sphäre begegnen wir fortwährend modalen Grenzverlusten, die jeglichen Aufenthalt zur Seinsfrage werden lassen kann. Architekturen verschmelzen zu "Zeiträumen", zu transmittierenden Räumen, die erst durch die Bewegungen ihrer Nutzer definiert werden. Wir bemühen uns zurzeit ein neues Vokabular von Gesten zu entwickeln, virtuelle Sphären zu erschließen, ohne aber schon sagen zu können, ob die neue Heimat des homo virtualis nicht unüberwindbare Widerstände bereithält, sich von seinen menschlichen Navigatoren überhaupt kolonisieren zu lassen. Diese Aussage erscheint zunächst bereits deshalb paradox, weil Cyberspace sich als ein weiteres Produkt menschlichen Ingeniums einleitete, das unsere Fernsinne um zusätzliche Dimensionen erweitert. Cyberspace wäre danach im McLuhan´schen Sinne eine Art Ausstülpung menschlicher Sinnesorgane, insbesondere eine Externalisierung seines biologischen Gedächtnisses. Wer Cyberspace als Medium instrumentell fasst, räumt ein, dass Instrumente Techniken voraussetzen, um sie zu dem zu formen, was ihr Potenzial birgt. Ein Instrument wird zudem nicht nur gebraucht, sondern instrumentalisiert in seiner alltäglichen Dialektik auch den Anwender, der in mehr oder weniger langen historischen Zeiträumen professionelle Handhabungen entwickelt. Technikgeschichte ist zugleich Sozialisations- und Herrschaftsgeschichte. Kein Medium kann im Zeitpunkt seiner Entstehung auf seine Gebrauchsweisen oder gar auf seine soziale Implikationen hin festgelegt werden. Erst lange Bemächtigungsgeschichten geben Auskunft über die pragmatischen Regeln und Extrapolationsmöglichkeiten für den zukünftigen Medieneinsatz. Bei wenig komplexen Medien, etwa klassischen Werkzeugen, war die Bemächtigungsgeschichte der Nutzer nicht nur lang, sondern auch die höchst bedingte Veränderlichkeit dieser Medien und "ihrer Umwelt" Gewähr für die immer perfektere Integration in das technische Gesamtwissen von Gesellschaften. Cyberspace strapaziert unsere Voreinstellungen über die Funktion von Medien, weil es sich um einen Navigationsraum handelt, der je verschiedene Formen der Medialisierung seiner Teilnehmer eröffnet. Cyberspace leitet sich so als eine mehr oder weniger autonome Sphäre ein, deren Werkzeugcharakter nur ein Moment eines sehr viel komplexeren Geschehens ist: Es konstituiert sich eine virtuelle Gesellschaft, die zwar Präzedenzen in der "wirklichen Wirklichkeit" besitzt, aber in ihrer Dynamik und ihren Akteuren nicht länger als Kopie dieser Welt gelten könnte. Auch wenn dieser Begriff längst nicht vollständig entfaltet werden kann, reicht als erste Annäherung die Antwort, dass Virtualität nichts anderes ist als eine veränderbare Wirklichkeit, die uns ständig mit dem Versprechen begleitet, so oder auch ganz anders sein zu können. Die Fantasie ist mithin an die Macht gekommen, aber anders als es die rebellischen Studenten forderten, nicht als Vernunft beflügelnde Einbildungskraft von Menschen, sondern als Wirklichkeit, deren vitalster Betriebsstoff eine technologisch emanzipierte Imagination bildet... Fortsetzung folgt ... eher nicht, das Phänomen "Netzliteratur" will mir nicht so recht erscheinen..Goedart Palm Zu Urheberrecht und anderen Rechtsfragen:
|