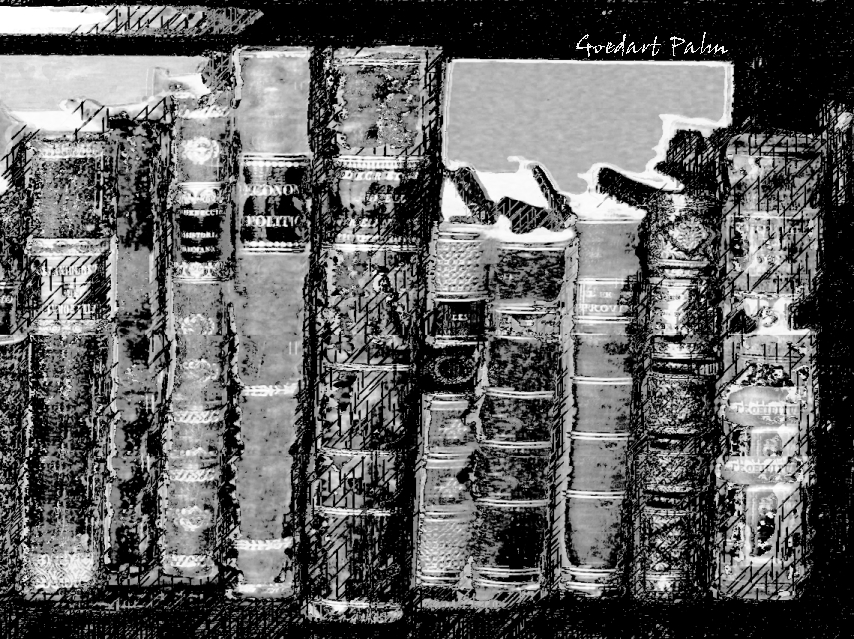|
|
Zur Zukunft des Lesens und Schreibens

Impression aus München - nahe Schwabing
|
"Sie
als Leser bleiben davon ja gottlob verschont. Hüten Sie sich aber vor der
gefühlsaktiven Version dieses Buches: Dann stecken Sie da nämlich
drin!"[1]
Noel
Gallagher von "Oasis" soll mit Zladko, dem im totalen
Medienabseits verschollenen Big Brother der ersten Containerstaffel,
gemeinsam haben, nie ein Buch gelesen zu haben. Wer sich so brüstet, kann
gleichermaßen auf Beifall gequälter Pennäler wie auf Verachtung bis
Mitleid seitens Bildungsbeflissener rechnen. Danach dürften Gallagher und
Zladko auch nicht den griechischen Mythos des König Cadmus kennen, der
mit der Einführung der phonetischen Schrift Drachenzähne gesät haben
soll, die sich zu bewaffneten
Männern verwandelten. Schreiben und Lesen, mithin die magischen Künste
des Alphabets, können nicht nur diesem Mythos zufolge als die tief
greifendsten Welterschließungs- und Beherrschungstechniken gelten, die
zur Ausbildung der uns geläufigen Schriftkultur führten. Das
Abendland hat verschiedene Untergangsvisionen und als eine davon gilt der
Verlust der Literalität im hemmungslosen Einbruch elektronischer Medien,
die Schrift, Sprache, Töne und Bilder in ihren hektischen Signalwelten
kurzschließen. Für Marshall McLuhan dagegen war es klar, dass die
Menschheit die Gutenberg-Galaxis unwiderruflich verlässt, um brüderlich
"Nichtalphabeten mit Halbalphabeten und Nachalphabeten" in den
elektrischen Medien zu vereinigen.[2]
Noch früher sah Salomo Friedlaender Funktürme als "antibabylonische
Türme" zu den Wahrzeichen des neuen Analphabetismus werden.[3]
Der unverschuldete Ausgang des Menschen aus der Literalität[4] in eine technologisch eingebettete Welt, die ihre schon je fragile Unterscheidung von Realität und Virtualität vollends aufgeben könnte, macht freilich Angst. Vor allem denen, die mit einem unglücklichen Begriff der Leseforschung als "tertiäre Analphabeten" bezeichnet werden: Menschen, die keine ausreichende Medienkompetenz besitzen, um mit den neuen Kulturtechniken des Computers und Internets umzugehen.
I.
Aliteralische Unzeitgenossen
Der
bildungsbürgerliche Griff zum guten Buch wird kulturapokalyptisch als
archimedischer Hebel überhöht, um die
Schriftkultur vor ihrem Einsturz zu bewahren. So beklagt
der Kommunikationswissenschaftler Philip A. Thompsen[5]
von der "West Chester
University" in Pennsylvania - einer von vielen -
die wachsende "Aliteralität" bei amerikanischen Schülern
und Studenten. Trotz der im Einzelfall mitunter bestehenden
Abgrenzungsprobleme ist Aliteralität nicht mit Illiteralität zu
verwechseln, denn aliterale Zeitgenossen haben schlicht kein Interesse an
Schriftzeichen, obwohl ihnen die Kulturtechnik "Lesen"
prinzipiell zur Verfügung stünde. Da die Kultur in der Sprache eingebaut
sei, befürchtet Thompsen mit vielen anderen Kritikern der neuen Leseschwächen,
dass sich die aliteralen Lesemuffel das kulturelle Erbe nicht aneignen könnten
- mithin untauglich seien, sich in dieser Welt zu orientieren.
Nun lässt sich der Umgang mit neuen und neuesten Medien zuletzt
auf eine geschlossene Kulturtechnik und schon gar nicht auf das Nichtlesen
reduzieren. Die visuellen Reizwelten des Fernsehens oder die auditiven des
Radios sind nicht mit den Anwendungsprofilen des Computers oder Internets
zu verwechseln. Gerade das Netz wächst mit babylonischen Textmassen zu,
die mehr denn je zum Lesen
zwingen. Email und selbst das allgegenwärtige Chatten - wider dessen
Selbstbeschreibung als Gespräch - sind Momente einer neuen elektronischen Schrift- und Lesekultur. Freilich sind die Differenzen
zwischen der elaborierten Briefkultur des 18.Jahrhunderts und diesen
digitalen Verschriftlichungen so gravierend, dass die Frage nach der
literalen Kompetenz verschiedene Schrift- und Lesetypen
unterscheiden muss.
Der
Kulturkritiker Barry Sanders konstatiert Mitte der 90er-Jahre in "Der
Verlust der Sprachkultur", dass die Mehrzahl der amerikanischen
Kinder heute in einer Umgebung aufwächst, aus der die Sprache getilgt
sei.[6]
Auch Neil Postmans Verdikt gegenüber der Kulturdemontage durch das
Fernsehen[7]
und den Verfall der Lesefähigkeit ist bekanntlich von der Wehmut nach
einer linearen Weltaneignung geprägt, die die Moral des Lesenden gleich
mitbesorgt. Noch im 18. Jahrhundert war der Beruf des Romanschriftstellers
unbekannt. Geschichten, die das Leben schrieb, waren mitteilungswürdig
und fiktive Geschichten waren tendenziell unanständig, überflüssig,
jugendgefährdend. Erst als der Roman seine sittlichen Qualitäten unter
Beweis stellt, wird er salonfähig. Diese Eigenschaften hat der Roman später
eingetauscht gegen das pralle Leben, die Irrungen und Wirrungen der
modernen Existenz, bis er schließlich seine Zentren und Ordnungen verlor
und an den Rändern zerfaserte. Seitdem herrscht Arbeitsteilung: Die ins
hardcover geschlagene Heftchenkultur reproduziert die geschlossene Form,
die Fortführung des modernen Romans besorgen die Neuen Medien. Das
Fernsehen erzählt und erzählt und erzählt, ohne noch Zentren zu
besorgen.
Nach
einer Gallup Erhebung aus dem Jahre 1999 sind lediglich 7 % der Amerikaner
unersättliche Leser, die mehr als ein Buch pro Woche lesen. Etwa 59 %
erklärten dagegen, dass sie in einem Jahr weniger als zehn Bücher
gelesen hätte - das ist immerhin die doppelte Anzahl von Büchern, die
der bundesrepublikanische Durchschnittshaushalt nach einer älteren
Untersuchung an Büchern überhaupt besitzt. Die Zahl der Nichtleser
steigt in den USA seit zwanzig Jahren kontinuierlich an. Besonders prekär
ist der Hinweis der "Organization for Economic Cooperation and
Development" aus dem Jahre 1998, dass 50% der arbeitsfähigen Bevölkerung
Amerikas nicht die literalen Eigenschaften besitzt, um in modernen
Wirtschaftsunternehmen erfolgreich zu arbeiten. Das Herrschafts- und
Erfolgsargument zu Gunsten der Lesekompetenz bleibt also trotz der
Ausblicke in eine elektronische Kultur erhalten. In Deutschland liegt nach
Schätzungen der deutschen UNESCO-Kommission aus den 90er-Jahren die
Analphabetenrate zwischen 0,75% und 3% der Bevölkerung.
II.
Von deutsche Leselöwen und -mäusen
Die
Stiftung Lesen[8]
hat auf Initiative des Bundesministeriums in Kooperation mit dem Börsenverein[9]
2530 repräsentativ ausgewählte Deutsche ab 14 Jahren durch das
IFAK-Institut persönlich zu ihren Lesegewohnheiten befragen lassen. 41 %
der 2530 Befragten nutzen mindestens einmal pro Woche Bücher, weitere 18
% kommen lediglich ein- oder zwei Mal im Monat dazu. Seltener als einmal
im Monat lesen 13 % der Befragten ein Buch, während die restlichen 28 %
überhaupt nicht zu Büchern greifen. Im Vergleich zu den Resultaten einer
vergleichbaren Studie aus dem Jahre 1992
bedeutet dies einen erheblichen Rückgang der Leseintensität. 1992 gab es
immerhin noch einen Anteil von täglichen Buchlesern von 16 %, während
diese Gruppe im Jahre 2000 auf sechs % geschmolzen ist. Der Anteil der
Nichtleser hat sich in dieser Zeitspanne von 20 % auf 28 % erhöht.
Insgesamt
hat sich die durchschnittliche Nutzungsdauer von Büchern reduziert. Die
Studie unterscheidet dabei zwischen Sach- und Fachbüchern sowie
Belletristik. Der Durchschnittswert für die Sach- und Fachbuchnutzung
betrug noch 1992 an einem Werktag eine Stunde und elf Minuten, die sich im
Jahre 2000 auf 55 Minuten reduzierten. Ähnliche Ergebnisse gelten für
die durchschnittliche Belletristiklektüre. Am Wochenende gönnen
sich die Deutschen zwar etwas mehr Zeit für die Lektüre, aber auch hier
sind Rückgänge zu verzeichnen. Allerdings reduzierten sich auch die täglichen
Zugriffe auf das Fernsehen in dem Vergleichszeitraum um zehn Minuten auf
zwei Stunden und 31 Minuten. Das TV bleibt also das Königsmedium der
Gesellschaft. Die Gegenläufigkeit von Fernsehen und Lektürekonsum ist
wenig erstaunlich. Besonders interessant sind die Zusammenhänge zwischen
Netzgebrauch und Buchlektüre: 22,0 % der täglichen Internet-User lesen
zugleich täglich in Sach- und Fachbüchern. Nur 11,0 % dieser Gruppe tut
dies seltener als einmal im Monat. Von den Netzabstinenten oder
Gelegenheitsusern lesen lediglich 2,2 % täglich, aber
"horrende" 58,1 % dieser Gruppe lesen weniger als einmal im
Monat in Sach- und Fachbüchern. Die Gruppe der täglichen
Online-Aktivisten weist also im Vergleich zu den offline lebenden
Zeitgenossen einen sehr viel höheren Anteil an täglichen Sach- und
Fachbuchlesern auf. Lektüre und Computer ergänzen sich mithin. Zudem hat
die Studie festgestellt, dass häufige PC-Nutzung zwar nicht unbedingt zum
häufigen Lesen von Belletristik prädestiniert,
umgekehrt ist das aber umso häufiger zu beobachten.
Fazit der "Ehrenrettung" der Computernutzer:
Medienkompetenz gegenüber dem Rechner impliziert Lesekompetenz.
Wolf-Michael Catenhusen, parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Bildung und Forschung bestätigte daher in seinem
Grußwort zum Kongress der Stiftung Lesen "Gutenbergs
Folgen" im Herbst 2000 die Lesefreunde: "Da die Anforderungen an
unsere Medienkompetenz in Zukunft noch wachsen werden, muss, wie aus
international vergleichenden Studien hervorgeht, auch das Niveau der
Basis- und Schlüssel-Qualifikation Lesen tendenziell höher werden. Es
erweist sich also, dass die "alte" Kulturtechnik Lesen geradezu
zur Eintrittskarte in die Computergesellschaft wird."
III.
Der "scannende" Leser
Aber
wie lange gilt das wirklich noch? Jenseits der Zahlen und der Hoffnung auf
den kulturellen Schulterschluss von neuen und alten Medien stellt sich die
Frage nach den Lektüregewohnheiten der neuen Leser. William Albert vom
"Terra Lycos Portal Design Lab" in Waltham, Massachusetts,
attestiert dem Typ des Internetlesers eine habituelle Ungeduld, die kurz
gefasst das Gegenbild des ausdauernden Bücherwurms darstelle. Der
netzorientierte Leser "scannt" die Texte, sucht Textbrocken
statt leseaufwändigen Texten, von Textwüsten ganz zu schweigen. Und wie
es nicht anders sein kann, wird diesem Lesertypus von den Kulturwahrern
das "Verständnis", die tiefe Durchdringung der Texte in ihrem
ganzen hermeneutischen Bedeutungsreichtum abgesprochen.
Gleichwohl
kann der Leser als schnell laufender "Scanner", als Über- und
Querleser, nicht als Bankrotterklärung der Literalität herhalten, weil
Literalität viele Formen jenseits der von Autoren vorgegebenen
Textverfassung entwickeln kann. Die Nichtlinearität der Leserichtung, das
sprunghafte Lesen, die Lektüre als persönliche Montage können gerade
aufgeklärte Lesehaltungen anzeigen, die dem Leser wieder die
Welterfahrung vermitteln, die in klassischer Literatur unterschlagen wird:
Das Leben ist weniger ein Roman, sondern ein patchwork mit mehr oder
weniger gelungenem Muster. Die Erscheinung des eigensinnigen Lesers findet
lange vor sprungfreudigen Netzlektüren ihr Gegenstück in weiten
Bereichen der (post)modernen "Hochliteratur", die vormalige
Textverfassungen aufsprengte und persönliche Lektüreweisen jenseits
linearer Leserichtungen nahezu unabdingbar machte. Oder wer liest "Finnegan´s
Wake" von James Joyce mit der derselben Ergebenheit in die
auktorialen Vorgaben wie Goethes "Wilhelm Meister"?
IV.
Nichtlesen verursacht Krebs
Barry
Sanders beschließt seinen Diskurs über den Verfall der Literalität
kulturapokalyptisch: Wenn das "tempus futurum" als der Ausblick
auf das Morgen und das Kontrafaktische, beides nach Sanders zentrale
Momente der Literalität, sterben, können die Menschen nicht mehr träumen.
Dann würden die seelischen "Innenräume" zerstört und
alles sei verloren. Nun ist die Bilderschrift des Traums, der nach
Freud ja auch erst gelesen werden muss,
keine literarische Errungenschaft, sondern prägte gerade orale
Kulturen in stärkerem Maße als unsere durch die Schrift vereinheitlichte
Kulturen. Das Kontrafaktische ist zudem eine menschliche Kondition, die
auch jenseits eines engen Begriffs des "Lesens" ihre Bedeutung
behält. Gerade in der Virtualität und ihren kühnen Versprechungen ist
das Kontrafaktische ein Antrieb, der wohl kaum auf klassische
Lesehaltungen angewiesen ist, noch damit zureichend zu verstehen wäre.
Ohnehin völlig untauglich ist die Festlegung eines menschlichen
Zeitbewusstseins auf die lineare Kulturtechnik klassischer Lektüren, ohne
die komplexen Zeitbilder von Kino, Fernsehen oder Comics zu berücksichtigen.
Eine elektronische Erlebnisgesellschaft, die Kommunikation zum Fetisch
erklärt hat, wird sich schwerlich damit abfinden, dass "Bücherlesen
heißt, in einer geistreichen Gesellschaft zu sein, wo man nur zuhört und
nichts beiträgt zur Unterhaltung", wie Jean Paul bereits mit
ironischem Unterton vor ungefähr zweihundert Jahren anmerkte.[10]
Die
Mahner und Warner vor dem Verfall des Literarischen werden indes jetzt
rabiat: der amerikanische Leseforscher Jim
Trelease[11]
will die Aliteralität wie Tabak bekämpfen, weil die schrecklichen
Konsequenzen der Unterlassung des Nichtlesers für dessen Familie und
Kinder unabsehbar seien. Verursacht Nichtlesen Krebs? Zumindest könnte
die Gefahr in jenen Fällen des "funktionalen" oder "sekundären"
Analphabetismus nicht völlig ausgeschlossen werden, wenn nach Barry
Sanders 70 % der Betroffenen zwar rudimentär lesen und schreiben können,
aber gegenüber schwierigeren Texten - wie Zeitungslektüren, Behördennachrichten
oder Beipackzetteln mit wichtigen Warnhinweisen - versagen. Der
Kommunikationswissenschaftler Philip Thompsen hat dagegen auf den
restriktiven Begriff von Literalität hingewiesen, der sich in der Fähigkeit
erschöpfe, Texte zu lesen. Das Lesen ist älter als die Schrift, wie die
Rede vom Buch der Welt/Natur, der "Lektüre" von außersprachlichen
Zeichen in Tiereingeweiden, den Konstellationen der Gestirne und tausend
anderen Zeichen Gottes belegt. Diese Verkürzung könnte mindestens so
fatal sein wie die kulturpessimistisch ermittelten Leseschwächen
nachwachsender Generationen, die Barry Sanders Glauben zufolge letztlich
in Gewalt und Rücksichtslosigkeit enden werden. Könnte es also sein,
dass der Verfall klassischer Lektürehaltungen mit avancierten
Kulturtechniken einhergeht, die erst ein angemessenes Verhältnis zu den
Umbrüchen der Welt begründen?
V.
Postliterale Welt
So
könnte auch das Literarische eine vorüber gehende Episode der
Welterschließung sein, der angemessenere Weisen folgen, in der Welt
verstehend zu handeln. “Die
Sprache ist eine Maschine, die Kontexte typisiert und einkapselt in jene
konventionalisierten Elemente, die wir Worte nennen und denen wir den
Prozess der Verdichtung, dem sie entstammen, nicht mehr ansehen.”[12]
In die Sprache der poetischen Kritik an der Sprache übersetzt heißt das
mit Paul Valéry, dass “die Sprache verdunkelt, weil sie zu Fixierungen
zwingt und weil sie dort verallgemeinert, wo man es nicht will”.[13]
Insoweit entvirtualisiert die Sprache ihre Objekte, um dadurch aber
zugleich in der Abstraktion der Schrift einen neuen virtuellen Raum zu
schaffen. Denn zwar ist der “Sinn der Buchstaben, die ich hinschreibe,
...durch Millionen Hände gegangen, aber das, was jedem von uns allein gehört,
ist die Art in der wir das Zeichen hinsetzen, so, als hätten wir es
gerade erfahren".[14]
Durch ihre Unvollkommenheiten, immer das zu bezeichnen, was wir bezeichnen
wollen und doch oft nur als ein “Ungefähr” verstehen, provoziert die
Sprache immer wieder die Notwendigkeit, die Wirklichkeit besser zu
erschließen, sie als Spielraum von unerschlossenen Möglichkeiten zu
begreifen. Paul Valéry wies darauf hin, dass gerade eine vollkommene
Sprache dazu führen würde, dass Menschen aufhören zu denken.[15]
Virtualität gedeiht im Unvollkommenen, Unvollständigen, in den Zwischenräumen
und Mängeln, die Menschen oder Maschinen antreiben, die Möglichkeiten
gegen das Reale auszuspielen und in den glückhafteren Momenten des Lebens
auch durchzusetzen. Die
Abbildung der Welt im Text hat seit Platon, der an der historischen
Schnittstelle oraler und literaler Kultur steht, viele Widersacher
gefunden. Die symbolische Welt in Schriftzeichen hat immer das Besondere
unterschlagen. Hegel konstatierte in seiner Ästhetik die Unzulänglichkeit
des Lesen und Vorlesens dramatischer Werke, weil der Fantasie das überlassen
bleibe, was doch erst die Inszenierung lebendiger Schauspieler erweisen könnte.
Aber das wirft nicht nur die Probleme literaturgattungsspezifischer
Differenzierungen auf, sondern immer schon die Frage, ob das Lesen als
"via regia" des Weltverstehens, so historisch unabdingbar es
war, nicht eben so viel an sinnlichen Erfahrungen geraubt wie an
abstrakt-analytischer Weltsicht geschenkt hat. Dass Lesen nicht nur
bildet, sondern auch verbildet, ist die hartnäckige Begleitmusik rein an
der Schrift orientierter Gesellschaften, die in Jean-Jacques Rousseaus
schriftlichem Erziehungshinweis kulminiert, dass Lektüre die "Geißel
der Kindheit" sei. Dem emanzipierten Ideal des lesenden Untertans
begegneten auch zahlreiche staatstragende Varianten der Lesefeindlichkeit,
um zu vermeiden, dass das Lesen Menschen auf dumme, also anarchische
Gedanken bringt.
Der
Groll auf die Lektüre findet ihren frühen Ursprung in Platons
Fundamentalverdikt gegenüber der Schrift in "Phaidros", weil
die Schrift nur ein schwaches Abbild der mündlichen Sprache sei,
geeignet, das Gedächtnis, aber auch die Deutlichkeit und Vollständigkeit
der oralen Vermittlung zu schwächen, auf die doch Menschen in ihrem
Weltverständnis angewiesen seien. Wäre die Kultur dem schreibenden
Schriftkritiker Platon und nicht dem Pragmatiker Gutenberg gefolgt, wären
die technischen Speicher der Bibliotheken und später Datenbanken nicht
entstanden, würde man vermutlich heute Platon nicht mehr kennen, weil auf
mündliche Überlieferungen wider alle Gedächtniskunst zuletzt Verlass
ist. So aber darf man sich für die Entstehung einer postliterarischen
Kultur, für die orale Verständigung unter den Bedingungen einer
technologisch "totalisierten" Welt wieder auf Platon berufen.
1.
In Bildern denken?
Vilém
Flusser hat im Verblassen der alphabetischen Kultur den Anhub einer
techno-imaginären Welt erkannt, in dem die technischen Bilder neue
"Begriffe" bedeuten, über deren Verwendung noch wenig bekannt
ist.[16]
Der Weg führe hinaus aus der linearen Welt der Schrift, des Lesens, der
Theorien und Ideologien zu "Modellen" als Bildern von Begriffen.
Béla Balázs hatte
bereits in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts angesichts der neuen
Faszination des Films vom Wandel der Wortkultur zur Kultur der Gesten und
der Mimik gesprochen. Antilineare Trends, televisuelle Bildkulturen prägen
Kino, Fernsehen, aber auch die digitalen Erlebniswelten virtueller Spieler
und Internet-Reisender. In
der Diffamierung der Bilder ist sich die konservative Kritik an den medial
verseuchten Welten mit der spätmarxistischen Gesellschaftskritik
bemerkenswert einig, weil der gemeinsame Grundtenor die ständig variierte
Angst vor dem Verlust des Wahren, der Wahrnehmung, des Authentischen ist.
Exemplarisch konstatiert der "Spektakologe" Guy Debord in der
Nachfolge der marxistischen Fetischtheorie der Ware, die auch die warenästhetischen
Betrachtungen von Wolfgang Fritz Haug
anleitet: "Da, wo sich die wirkliche Welt in bloße Bilder
verwandelt, werden die bloßen Bilder zu wirklichen Wesen und zu den
wirkenden Motivierungen eines hypnotischen Verhaltens. Das Spektakel als
Tendenz, durch verschiedene spezialisierte Vermittlungen die nicht mehr
unmittelbar greifbare Welt zur Schau zu stellen, findet normalerweise im
Sehen den bevorzugten menschlichen Sinn, der zu anderen Zeiten der
Tastsinn war...”.[17]
“Das
Datenuniversum tritt ein Erbe an, das es von den Bildmedien übernimmt,
und die gemeinsame Basis ist der Antrieb, die Defekte der Sprache zu überwinden”[18],
meint Hartmut Winkler. Eher dürfte es indes so sein, dass alte Defekte
gegen neue Mängel ausgetauscht werden, wenn Texte, Töne und Bilder nicht
als korrespondierende Welterschließungsweisen eines komplexen
Wahrnehmungskosmos begriffen werden. Gerade die allgegenwärtige
Herrschaft des "bugs"[19],
die Unbotmäßigkeit von Betriebssystemen und Anwendungssoftware
verunsichert dieses fragile Datenuniversum und seine Bewohner mindestens
ebenso sehr wie die Unzulänglichkeiten der Sprache. Positiv formuliert
gibt es eine virtuelle Verständigung jenseits der Sprache, deren
Herrschaft sich mindestens relativiert, wenn wir uns in Cyberspace
bewegen. Bazon
Brock ist der Ansicht, dass wir inzwischen auch gelernt haben, in Bildern
zu denken.[20]
Für Brock besteht trotz der Eigengesetzlichkeit der Medien die Möglichkeit
der nichtidentischen Übertragung von Texten in Bildern und Bildern in
Texte. Wir verbinden seit je Bilder zu Geschichten, ohne zwingend auf die
“Krücken” der Sprache angewiesen zu sein. In alten Stummfilmen
erkennen wir Handlungen und verstehen die Geschichte auch ohne die Gespräche
der Schauspieler. Aber nicht alles kann man in Bildern mitteilen.
Zumindest ist es umständlich und eine “International
Picture Language”,
wie sie Otto Neurath vorschwebte, hat sich nicht durchgesetzt, zumal jede
diskursive Differenzierung in solchen Bildsystemen zwar nicht a priori
ausgeschlossen, aber doch durch kulturelle Voreinstellungen stark
behindert ist. Auch die viel beschworene Filmessayistik, wie sie Jean-Luc
Godard als Vereinigung verschiedener Filmsorten vorstellte, um
unterschiedliche Abstraktionsstufen des Films zu generieren, ist Episode
geblieben. Sergej Eisenstein wollte gar das "Kapital" von Karl
Marx verfilmen.[21]
Dieser Anspruch konnte freilich schon deshalb nicht eingelöst werden,
weil der abstrakte Gedanke gerade den Assoziationsreichtum, die subjektive
Konfabulation des Betrachters und die sinnliche Potenz von Bildern meidet.
Jedes Bild steckt regelmäßig in einem mehr oder weniger komplexen
Verweisungskontext: Es gibt Rahmen, Untertitel, Kommentare, Montagen, die
erst den Zusammenhang einer Bildaussage konstituieren. Wir sehen auch im
Netz fast immer Montagen aus Bildern[22],
Texten, Sprache, die auf den üblichen Benutzeroberflächen von Computern
oder bei Websites zudem sehr redundant gestaltet sind, um auf diesem oder
jenem Wege zur gewünschten Information zu gelangen. Deshalb ist es eher
spekulativ, über die reine Wirkung von Bildern nachzudenken, zudem ihre
"Kontextualisierung" durch den jeweiligen Betrachter
psychologische Dimensionen hat, die das Bilderleben nur bedingt
austauschbar macht, sondern höchstpersönliche Erfahrungswelten
voraussetzt, die das ganze Spektrum eines Menschen betreffen.
Schließlich
ist auch die Frage zu beantworten, ob nicht virtuelle Bilder einer
fundamental anderen Ordnung angehören, als die mit klassischen Medien wie
dem Fotoapparat oder der Filmkamera hergestellten. Ihre Generierung und
Lesbarkeit wäre vorrangig nicht aus der Korrespondenz oder Abweichung zu
einer vorgängigen Wirklichkeit zu verstehen, auch wenn "die Kamera
und ihr Produktionsprozess ein wichtiger Referenzpunkt"[23]
bleiben mag. Virtuelle Bilder wären genuiner Schein, hinter dem sich kein
Gegenstand verbirgt. In dem Film "Kein Rauch ohne Feuer" (1973)
von André Cayatte stellt ein Fotograf die Frau eines Politikers in
pornografische Collagen, die auch bei genauester Betrachtung nicht mehr
als künstliche Inszenierungen zu erkennen sind. Die Diffamierungskampagne
ist erfolgreich. Die virtuelle Lüge wird nicht erkannt und schiebt sich
vor die Wahrheit. In unserer virtuellen Bildkultur kehrt sich, wie auch
zahlreiche Fakes anlässlich des 11.September 2001 belegt haben, die
Beweislast um. Ein Bild ist ein Bild ist ein Bild - zumindest was seinen
Anspruch auf Abbildung der Wirklichkeit betrifft.
2.
Neue Rollen in der Wörterküche
"Und
die Praxis in der Wörterküche der Poesie ließ mich klar erkennen, dass
uns Kombinationen von Wörtern deshalb möglich sind, weil sie keine -
Dinge sind" konstatiert Paul Valéry.[24]
So verleiht die poetische "ars combinatoria" zwar Macht im Reich
der Sprache, aber der Dichter vermag keine neue Ordnung der Gegenstände
jenseits dieser Zeichen zu konstituieren. In den vormals so gefestigten
Glauben an die Demiurgenkunst der Poeten drängte sich im Laufe ihrer Schöpfungen
immer stärker der Zweifel, der Wirklichkeit in der Virtualität der
Zeichen je beikommen zu können. Es geht mithin nicht länger um die
vordergründige Oppositionen von Schrift und Sprache, Lesen und Sprechen
oder Bildern und Schrift, die längst nicht mehr in den diffusen
Zeichenwelten des Netzes gültig sind, sondern um eine neue
Begrifflichkeit der Medialität. Die
Rollen zwischen Schreiben und Lesen lösen sich spätestens in dem Moment
auf, als Mallarmé den Leser als “Operateur” bezeichnet. Auch die Lektüre
ist eine Operation, bei der sich der Leser ein Urheberrecht über das Werk
anmaßt[25].
Mit der Geburt des "Users" und seiner avancierten Technologie
verschiebt sich das virtuelle Leben indes ungleich stärker weg von der
mehr oder minder kontemplativen Rezeption von Literatur, Dichtung, Musik
oder Film zur (Mit)Gestaltung eines Werks. Die Rolle des Autors wird neu
gefasst. Auf
Grund der rasanten Emergenz von immer komplexeren Weltverhältnissen löst
sich auch die gleichsam naturwüchsige Materialbeherrschung durch das künstlerische
Subjekt auf. Der Literat wird zum Archivar, Monteur, Kompilator oder
Sammler. Während Joyce, Döblin, Schwitters oder Jandl ihre literarischen
Sprengungen noch in der lustvollen Herrschaft über gefundene Versatzstücke
ausüben durften, schlagen die aufdringlichen Fundstücke heute zurück,
unterwerfen Literaten und Leser einem nicht endenden "overload"
von Informationen, die nicht mehr im Text sinnfällig verfugt werden können.
Das Scheitern der Literatur an einer entgrenzten Welt wurde zu einer häufig
beobachteten Kondition der klassischen Moderne. Der "Mann ohne
Eigenschaften" von Robert Musil ist ein herausragendes Beispiel für
die Nichterzählbarkeit der Erfahrung in einem geschlossenen Text. Die
Perspektive des "inneren Monologs" hat die Grenzenlosigkeit des
Erfahrungsraums zum potenziell unendlichen Text werden lassen. So wurde es
paradigmatisch, dass in "Finnegan´s Wake" von James Joyce die
Grenzen der einsinnigen Mitteilung erreicht und überschritten werden, was
sich nicht zuletzt in der Unübersetzbarkeit dieser virtuellen Sprache
niederschlägt. Die Zahl der unabgeschlossenen Literaturentwürfe nimmt
zu. Literatur entgrenzte sich bei gleichzeitiger Schwächung ihrer
gesellschaftlichen Stellung in einen unendlichen Kosmos, der Gattungen und
Formen auflöste. Die Grenzgänge der literarischen Gattungen haben diese
schließlich verwischt. Insbesondere der Roman als eine Großform ohne
Form hat Einlassöffnungen für fast jede beliebige Textpraxis geschaffen,
bis die Kontingenzen den Leser überspülten. "Die Literatur ist ein
schwieriger, schmaler, tödlicher Stand geworden"[26],
notiert Roland Barthes 1957. Kempowski veröffentlicht sinnloses "channel-hopping"
in "Bloomsday" als bewusst inszenierten Medienbruch, von dem
niemand mehr sagen kann, wo dieser Text über die unhinterfragte
Aufzeichnung des Geschehens hinausgeht. Rainald Goetz, den früher Ähnliches
umtrieb, hat gar den "Rave" entdeckt, dessen leibliche Resonanz
die Texte beflügeln soll. Die Legitimationen solcher Unternehmungen sind
vordergründig und nicht mehr vom "Abfall für alle" zu
unterscheiden. Beliebigkeitscollagen à la Kempowski beinhalten nicht viel
mehr als die selbstgewisse Aussage über die Beliebigkeit medialer
Inhalte, die wir doch immerhin mit unserer schwankenden Kraft zur
Selektion zu durchbrechen zu versuchen. Goetz mag zwar dunkle Zusammenhänge
zwischen Techno-Beat und Text-Beat einflüstern, aber eine
nachvollziehbares „Cross-over“ will daraus auch nicht werden. Solche
Literatur folgt dem Prinzip, dass alles "irgendwie" zusammenhängt
und Semantik der selbstverständliche Mehrwert jedes Textes gegenüber
seinen Gegenständen ist - solange der Leser als Ko-Autor kräftig
mitspielt.
Der
fundamentalistische Katholik McLuhan hat angesichts des
"Elektronengehirns" den nächsten logischen (sic!) Schritt zum
kollektiven Heil darin gesehen, die Sprachen zu umgehen und auf einen
Zustand der harmonischen "Sprachlosigkeit" zu hoffen.[27]
Auch wenn der Vorwurf des "audiovisuellen Primitivismus"
McLuhans Hoffnung auf ein kosmisches Bewusstsein unangemessen verkürzt[28],
beflügelt diese eschatologische Vision keineswegs das gegenwärtige Globalisierungsbewusstsein von vielen heterogenen kulturellen
Vermittlungsweisen, die sich längst nicht in Luft auflösen. Zumindest
jedoch gerät die klassische Trias von Sprache, Schrift und Bild im
Netzgewebe in Bewegung.[29]
Wenn aber die Formen und ohnehin nie völlig diskreten Grenzen zwischen
den Zeichen- und Abbildungssystemen zu tanzen beginnen, werden auch Lesen
und Schreiben, wenngleich sie gegenwärtig noch eine zentrale Position
einnehmen, als virtuelle Kulturtechniken nicht mehr ausreichen.
"Computer Literacy" oder "Media Literacy"[30]
markieren den synthetischen Anspruch, die mediale Kultur in ihrem
Cross-over von Produktions- und Rezeptionsweisen, Schrift und Bild, vor
allem aber: in virtuellen Bewegungen zu erfassen. Vielleicht gilt also: "Die
Sinneserfahrungen und das analytische Vermögen schließen sich über
Internet zum Weltinnenraum zusammen."[31]
Der
VR-Pionier Jaron Lanier[32]
hat in den 1980er Jahren jedenfalls eine Verschmelzung der neuen
Technologie mit geistigen Prozessen prognostiziert. Eine postsymbolische
Kommunikation in virtuellen Sphären sei nicht länger auf Sprache und
nicht einmal auf Bilder angewiesen. Das Bewusstsein virtualisiere sich
ohne symbolische Vermittlungen, allein Gesten und Grimassen reichten wie
in vorsprachlichen Zeiten zur Verständigung aus.[33]
In Laniers telemimischer Welt klappt die Medialisierung durch Zeichen also
in eine technologisch-mental abgesicherte Unmittelbarkeit von Cybernauten
um, die nur an Objekte denken müssen, um sie bereits erscheinen zu
lassen. Diese sprachlose Beseelung von Cyberspace beantwortet aber längst
nicht die Frage, wie die Vielzahl der uns bekannten kommunikativen
Situationen, der hochdifferenzierten Sprechakte und auch die unauslotbare
Virtualität des Sprechens selbst zu einer plausiblen Ordnung der
Kommunikation aufschließen sollten. Zumindest ist die Vision Laniers von
einem gestisch-mimischen Repertoire des "Cyberbewusstseins" abhängig,
dass nicht hinter dem Unterscheidungsvermögen und den in jedem Gespräch
vorausgesetzten Anschlussmöglichkeiten zurückstehen dürfte. Diese
Virtualisierung eines Bewusstseins ohne sprachliche "Krücken"
folgt untergründig dem Bild von vernetzten Gehirnen, die qua
Cybertechnologie gleichsam telepathisch kommunizieren. Abgesehen vom
spekulativen Charakter dieser uncodierten Kommunikationstechnik verstört
an diesem Ausblick die Verschmelzung von Bewusstseinen, die gerade keine
Kommunikation in unserem Sinne mehr wäre, weil jede Mentalreservation,
jede Schließung des eigenen Bewusstseins gegen das fremde, äußerst vage
bliebe. Das
Internet als Hypertextmaschine desaovouiert längst nicht klassische Lektüren
und Interpretationstechniken, ohne dass es darin sein Bewenden haben könnte.
Die Schrift, die vormals die oral geprägte Kultur, von einigen Ethnien
abgesehen, liquidierte, könnte dann selbst in einer techno-oralen Kultur
aufgehen, die sich nicht länger ausschließlich über Texte vermittelt.
Noch benötigen zwar Programmierer Sprachen bzw. Codes, müssen mithin
selbst Sprachkompetenz besitzen, um eine techno-orale Gesellschaft zu ermöglichen,
in der reine Anwender von fremder Literalität abhängen.[34]
Die Entwicklung des Mensch-Maschine-Gesprächs ist unabsehbar und mag auch
den Verlauf nehmen, die literale Vermittlung schließlich völlig
aufzuheben. Vielleicht sind also Nichtlese-Riesen Noel Gallagher und
Zladko auf dem richtigen Weg in die Zukunft, nur - sie wissen es nicht,
weil sie dafür gegenwärtig zumindest noch lesen müssten!
[1]
Andreas Winterer (2000), S. 235. [2]
Marshall McLuhan (1992), S. 27 [3] Friedrich Kittler (1993), S. 161 ff. (173). [4] Weiterführend: http://www.literalitaet.ch/home.htm [5] http://communication.wcupa.edu/faculty/thompsen/ [6]
Barry Sanders (1995). [7]
Neil Postman (1988). [8]
http://www.stiftunglesen.de/index_html.html [9] http://www.boersenverein.de/ [10]
Jean Paul (1996), S. 50. [11] http://www.trelease-on-reading.com/bio.html [10] Hartmut Winkler (2002), S. 288 f. [13]
Paul Valéry (1987), S.
472. [14]
Jean Tardieu (1965), S. 11. [15]
Paul Valéry, aao., S.
499. [16] Vgl. Vilém Flusser (1993), S. 63 ff. [17] Guy Debord (1978), S. 18. [18] Hartmut Winkler, aaO., S. 332. [19] Dazu Edward Tenner (1997), S. 32 ff. Der Begriff "bug" wird schon von Thomas Edison 1878 verwendet und war schon zu dieser Zeit geläufig. [20] Bazon Brock (1986), S. 167 ff. [21] Béla Bálazs (2001), S. 74. [22] Das gilt selbst für die vorgeblich kontemplative Museumskunst, die mit Bildhinweisen ausgestattet wird, damit nur keiner Bildtitel oder Künstler "übersehen" möge. [23] Peter Brinkemper (2003), S. 15 ff. (S. 25). [24]
Paul Valéry (1987), S. 223. [25]
Maurice Blanchot (1982), S. 329. [26]
Roland Barthes (1964), S. 67. [27]
Marshall McLuhan (1992), S.
99. [28] So Lewis Mumford (1977), S. 674 ff., für den das "global village" Humbug ist. [29] Vgl. dazu etwa Mike Sandbothe unter: http://www.uni-jena.de/ms/teil1.html. [30] Vgl. etwa http://www.medialit.org/ [31]
Beat Wyss (1997), S. 83. [32] http://www.well.com/user/jaron/ [33]
Vgl. Lev Manovich (2001),
S. 58f. [34]
Vgl. etwa Gerald M. Phillips, A
Nightmare Scenario: Literacy and Technology, http://www.uni-koeln.de/themen/Internet/cmc/text/phillips.94b.txt.
|
|
"Alles in unserem Kopfe ist dem Zwang des Augenscheins unterworfen; wir sind nicht für die Wahrheit geschaffen, und die Wahrheit geht uns nichts an. Die optische Täuschung allein soll man erstreben." (Abbé Galiani) |
|
|
Noch mehr Aktuelles von Goedart Palm unter webdiarum