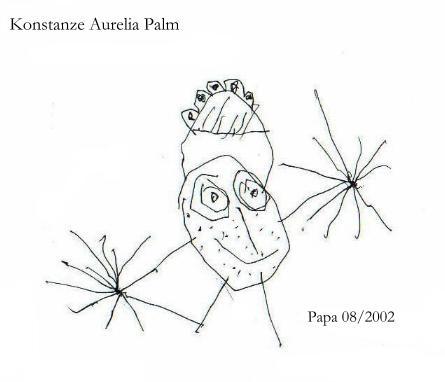|
|
Gegen eine Phänomenologie
der
Medien
(Erste Fassung)

Phänomenologisch können Medien danach differenziert werden, wie wir mit ihnen umgehen. Ontologisch entspricht dem, dass einzelne Medienkonstruktionen einen Punkt auf einer technischen Entwicklungslinie einnehmen, auf einer Form insistieren, der sie zu Phänomenen werden lässt. So festigte sich etwa das Fernsehen zu einem System technischer und sozialer Eigenwertigkeit. Der relativen Geschlossenheit eines technischen Mediums korrespondieren "Gesten", die vorausgesetzt werden, wenn Medien Wirkungen entfalten sollen und wir unseren Umgang mit ihnen beobachten. Wir berühren sie, nehmen Haltungen ein, entwickeln Konventionen und Vorlieben. Medien sind in ihrer Instrumentalität zugeschnitten auf unseren Körper. Medienkontakte setzen ein interface voraus, technisch-biologische Schnittflächen, die systemtheoretisch formuliert "Interpenetrationen" eröffnen. Was liegt also näher, als Vermittlungsverhältnisse von Menschen und Medien in ihrer phänomenologischen Praxis besser zu verstehen, wenn Gesten beschrieben werden. Vilém Flusser plädiert für eine allgemeine Theorie der Gesten, "ein Instrumentarium zur Orientierung in der Situation, in der wir uns den Dingen und den Menschen gegenüber befinden" (Vilém Flusser, Gesten. Versuch einer Phänomenologie, 2. Auflage 1993 Düsseldorf, S. 217). Die Kompetenz einer allgemeinen Theorie der Gesten wäre, Ausdrücke von Freiheit zu untersuchen und systematisieren (S. 220). Gesten als Freiheitsmodus betreffen danach das Verhältnis von Körper und Werkzeugen. Flusser will in in diese allgemeine Theorie anthropologische, psychologische, neurophysiologische und kommunikationstheoretische Aspekte integrieren, um sie interdisziplinär und antiakademisch werden zu lassen. Welchen Gewinn hat eine allgemeine Theorie der Gesten? Ein Klassifikationssystem der Gesten zielt auf die Erhöhung der Freiheit und die Möglichkeit, umfassende Gesten überhaupt durchführen zu können. Neue Medien entfalten ihre Potenzen erst im Umgang mit ihnen. Vor der remote control kannte niemand das "zapping". So hatte schon Edmund Husserl die Aufgabe der transzendentalen Phänomenologie darin gefunden, in der Einheit einer systematischen Ordnung alle Gegenstände möglichen Bewußtseins zu ermitteln (Edmund Hussserl, Cartesianische Meditationen, S. 56). Medienphänomenologisch wäre etwa McLuhans "The medium is the message" nach Flusser auf eine Verwechslung der Ausdrucksgesten mit kommunikativen Gesten zurückzuführen. Und in der Tat: Wer nur fernsehen will, ohne sich um die Inhalte zu bekümmern, wird auch mit außermedialen Botschaften konfrontiert, die sich nicht aus der Selbstvermittlung des Mediums lösen lassen. Diese Differenzierung von Ausdruck und Kommunikation verspricht, unsere Selbstvermittlungen im Medium nicht als dessen Autonomie zu erfahren, sondern Medien zu instrumentalisieren, etwa für kommunikative Zwecke. Kommunikation setzt differente Körper mit kompatiblen Strukturen voraus. In der Einheit der Differenz von Apparaten und Körpern, Bildern und Sinnen bleibt eine Theorie der Gesten sinnvoll. Medienphänomenologie wäre danach eine Art kognitiver Schadensbegrenzung von Kommunikationsmängeln. Nun steht und fällt eine allgemeine Theorie der Gesten aber nicht nur mit der Klassifizierbarkeit von Gesten, sondern setzt sowohl eine instrumentelle Kontur der Apparate wie auch typische Wahrnehmungsmodi voraus. Ohne Apparate und ihre Emanationen, die sich von ihrer Umwelt unterscheiden, wäre es sinnlos, Gesten zu untersuchen. Das scheint intuitiv wenig zweifelhaft, weil nicht nur das Fernsehen, sondern auch Telefon, Computer oder Internet apparative und gestische Komplementarität aufgrund formaler Geschlossenheit besitzen. Zwar sind die symbolischen Systemebenen komplex und Kategorien stoßen sich immer wieder an der Mannigfaltigkeit von Bild- und Tonverhältnissen, aber wir betrachten Medien als mehr oder weniger redundante Anwendungsfälle ihres "In der Welt Seins". Apparate folgen ihrer inneren Konstitution, sie setzen Codierungen voraus, denen sie gehorchen und in denen sie sich von anderen unterscheiden. Nun haben Berührungen von biologischen und technischen Apparaten nicht nur Spekulationen über Körperinvasionen, über den Austausch von natürlichen und künstlichen Funktionen ausgelöst, sondern auch über die ontologischen Status von Medien - etwa Menschen. Ontologie ist ein Formproblem. Der Blick auf die Evolution natürlicher Formen begründet unsere intuitive Dialektik von Konstruktion, Auflösung und Neukonstruktion. Auch der Mensch ist nur solange Mensch, wie er seine Kontur gegenüber den Anmutungen seiner Umwelt behält. Stirbt er, ist er nicht länger Mensch: "Tote sind Dung" meint Max Horkheimer, aber diese säkulare Feststellung ist ontologisch nicht länger befremdlich. Nun wird man kein Verhältnis zu dieser paradigmatischen Umstellung finden, wenn klassische Medien auf den menschlichen Wahrnehmungsapparat bezogen bleiben. Eine Brille verändert zwar meine Weltsicht, aber meine Körperfunktionen, mein In-der-Welt-Sein, bleibt an die Konstituentien klassischen Sehens gebunden. Die ontologische Sicherheit verliert sich sofort, wenn etwa technische Implementationen im Bereich der Gehirnfunktionen das Verhältnis von Gedächtnis und Vergessen verändern. Würde das Bewusstsein keine Informationen mehr diffundieren lassen, wäre das nicht nur eine Erweiterung des Gedächtnisses, sondern ein paradigmatischer Bruch in der Selbsterfahrung des Menschen. Jeder Technologie ist der Vorgriff auf solche Entphänomenologisierungen und Neuverortungen der Vermittlung implizit. Ausgangspunkt mag McLuhans Intuition gewesen sein, dass Medien natürliche Wahrnehmungen verstärken. Solange wir von einem abstrakten Medium ausgehen wie dem elektrischen Licht, ist dieser Sachverhalt ohne ontologischen Niederschlag. Auch wenn unsere Instrumente wachsen, bleibt doch die Kontur erhalten. Längst hat sich aber in der Vision zukünftiger Entwürfe diese einfache Verlängerung der Sinne aufgelöst. Wir vermuten in Medien neue Subjektformen, ohne mit dem Begriff des Subjekts vielmehr zu meinen als eine autopoietische Geschlossenheit einer anderen Existenz. Wir dringen in Mikro- und Makrosphären ein, besuchen unseren eigenen Körper, Körper schließen sich zu einem globalen Bewusstsein zusammen. Technische Entwicklungen können daher nur dann als eine Veränderung von Natürlichkeit und Künstlichkeit verstanden werden, wenn Wahrnehmungsformen, mithin Handeln, sich aus alten konstitutiven Bezügen löst. Ein Wahrnehmungsapparat, der neue Sinne besitzt, wirkt nicht nur auf alte zurück, sondern wird auch seine Weltbezüge soweit radikalisieren, dass sich der ontologische Status des Subjekts verändert. Ein Körper mit einer anderen Energiepolitik - etwa in einer Umstellung hormoneller oder enzymatischer Funktionen - verlässt nicht nur den tradierten Körper, sondern produziert neue Gesten. Diesem Vorgriff auf ontologische Umstellungen korrespondieren epistemologische Veränderungen, von denen nicht gesagt werden kann, welche kategorialen Folgen sie haben werden. Kommen wir auf die allgemeine Theorie der Gesten zurück, können wir aber unseren kartesianischen Zweifel an der Klassifizierbarkeit von Gesten validisieren. Es kann eine allgemeine Theorie der Gesten nur geben, wenn eine fundamentalontologische Sicherheit bestehen bleibt, dass Körper Körper, Menschen Menschen, Bilder Bilder etc. bleiben. Seit Husserl hat die Phänomenologie aber ihr eigenes Gefahrenmoment vernachlässigt. Der blinde Fleck der Phänomenologie ist das Phänomen selbst, soweit es in einem ontologischen Apriori wurzelt. Husserls "Zurück zu den Dingen" war eine folgenreiche Absage an den Realismus, in dem sich der starre Gegensatz von Subjekt und Objekt in noetisch-noematischen Strukturen auflöst, d.h. erst im intentionalen Bewusstsein wird der Gegenstand konstituiert. Aber auch das Noema als realer Gegenstand in phänomenologischer Reduktion kann sich nur in der Perspektivität eines Dings erfüllen, das eben seine Identität behält, auch wenn sich seine Wahrnehmung verändert. Die Verbundenheit von Gegenstand-Welt und Ich-Welt geht zwar von einer Struktur aus, hängt von elementaren Wirklichkeitsdimensionen ab. In der Virtualisierung von Wirklichkeitsdimensionen verschiebt sich aber die klassische Fragestellung weg von der Wahrnehmungskonstitution zu den faktischen Vorbedingungen, zu den Entitäten. Auch wenn diese nach phänomenologischer Betrachtung nur als wahrgenommene existieren, erfahren wir unsere Wahrnehmung als geprägt durch raumzeitliche Vorbedingungen. So können etwa "Elektrizität", "Ultraschall" mit traditionellen Sinnesorganen nicht wahrgenommen werden. Dabei soll hier nicht interessieren, ob Virtualität und Realität eine nicht länger differenzierbare Sphäre werden, sondern ob phänomenologische Konstruktionen in der Leiblichkeit des Menschen noch auf greifbare, berührbare Wahrnehmungsgegenstände stoßen werden. Das begründete eine phänomenologische Gemächlichkeit der Betrachtung, die zwar nicht länger das Wesen im Ding, sondern im Bewusstsein verortet, aber in der Abkehr von einem planen Realismus, von einer Vulgärontologie fester Weltbezüge, sich des Zugriffs des Bewusstseins auf Gegenständlichkeit sicher wähnt. Auch Flussers "Gestologie" meint nichts anderes als Bewusstseinsakte, die relativ gesicherte Dingkonstitutionen a priori voraussetzen. Jedes Gegenstandsbewußtsein setzt das "Sich-selbst-Gleichbleibende" im Perspektivenwechsel auf Objekte voraus. Wenn aber technologischer Fortschritt nur mehr als eine fortschreitende Entphänomenologisierung und Neukonstitution von Erscheinungen beschrieben werden könnte, wären Gesten Fixierungen auf Gegenstände, die nur noch retrospektiv existieren. Selbstverständlich hat die Phänomenologie ihren Anspruch zugleich in der Veränderung absichern wollen. Flusser zielt auf keine Theorie der unveränderlichen Formen, die am Ideal messen, was der Praxis standhält, sondern will empirisch-experimentelle Modelle angeben, die eben keiner Urform folgen, sondern veränderbar sind (Flusser, Lob der Oberflächlichkeit, S. 273 f. ). Aber auch diese Modelle gründen auf einer Potentialität von Gegenständen, die aus ihrer Gegebenheit ableitbar ist. Wer "für eine Phänomenologie der Medien" plädiert, wird nach wesensgerechten Aspekten suchen, die sich gegen die Gewohnheit des Umgangs mit ihnen richtet. So wäre etwa das Fernsehen nicht länger als ideologisches Instrument zu nehmen, sondern als "kosmische agora" (Flusser, Lob der Oberflächlichkeit. Für eine Phänomenologie der Medien, S. 199 - 1974 geschrieben!). Nun wäre, ohne zu den politischen Implikationen Stellung zu nehmen, das Internet danach nichts anderes als eine zur phänomenologischen Vernunft herangereifte Fernsehgesellschaft, eine in den Worten Husserls gesprochen, "offene Monadengemeinschaft, die wir als transzendentale Intersubjektivität bezeichnen" (Husserl, S. 133). Aber die ethische Beruhigung, die sich hier in der Wesensschau einstellt, verflüchtigt sich, wenn man nicht länger den Lichtmetaphern der Aufklärung, sondern Geschwindigkeitsmetaphern folgt. Phänomenologie ist eine Art der Lichtführung, die immer wieder Strahlen auf Gegenstände treffen lässt, die sich trotz ihrer raumzeitlichen Bewegungen identifizieren lassen. Verlegt man aber die Bewegung in das Innere der Phänomene, bewegt sich das Phänomen selbst in der Zeit immer schneller, so werden phänomenologische Betrachtungen "unwesentlich" im strengen Sinne, weil sie nur das zu fassen vermögen, was bereits vergangen ist. Daran ändert auch die Potentialität der Wahrnehmung, ihre Extrapolation auf zukünftige Zustände wenig, weil auch dieses vorgreifende Vermögen auf die Verfestigung von Wahrnehmungsoptionen gerichtet ist. Wer diesem Zug der Phänomene nicht folgen will, mag folgendes Beispiel dienen: Würde etwa eine Kommunikationsgemeinschaft mediale Formen asymmetrisch verteilen - einige korrespondieren mit Briefpost, jene mit Telefon, wieder andere mit e-mail - würden permanent Desynchronisierungen auftreten. Der Brief trifft etwa ein, wenn die elektronische Kommunikation schon einen anderen Punkt der Verständigung erreicht hat, das e-mail trifft auf eine Vergangenheit, die nicht mehr einlösbar ist etc. Nicht anders führt aber die phänomenologische Arbeit an den Medien zu theorie- und praxisschwachen Modellen, wenn Medien nicht zuvörderst durch ihren Umgang, der ja wider die Konvention veränderbar sein könnte, sondern durch ihre apparative Entwicklungsgeschwindigkeit bestimmt werden. So würden etwa Kommunikationsweisen, lebensweltliche, aber auch wissenschaftliche oder künstlerische, in einen Zugzwang der Wahrnehmung geraten, der Konventionen nur zum Preis ihrer Antiquiertheit eröffnet. Günther Anders hat darin die conditio humana erkannt. Wahrnehmungen setzen die Spannung von Ding und Wahrnehmungsfeldern voraus. Die Qualitäten von Wahrnehmungsfeldern entscheiden über das Wahrnehmbare. Die Zahl dieser Wahrnehmungsqualitäten ist unendlich, da sie sich geschichtlich entwickeln und die Zukunft der Wahrnehmung unabgeschlossen ist. Niemand kann ein Ding sehen, wenn es nicht "in situ" erscheint. Dieser unendliche Prozess sich neustrukturierender Wahrnehmungsbeziehungen von Feld und Ding geht aber von einer Konstante aus. Protention und Retention der (biologischen) Wahrnehmung halten das Phänomen in seiner fest. Nun stützen sich Wahrnehmungsfelder aber nicht nur auf das Beharrungsvermögen des Gegenwartsbewusstseins, sondern auf eine relative Geschlossenheit der vorausgesetzten Wahrnehmungsqualitäten. So wird etwa ein abgestuftes Wahrnehmungsfeld "Landschaft", "romantische Landschaft" etc. vorausgesetzt, um Konkretisierungen des Phänomens zu ermöglichen. Würde das Wahrnehmungsfeld selbst beschleunigt, so würden permanent neue Qualitäten erscheinen, die jede Situierung sogleich an ihre historischen Nachfolger abtreten. Das alte Scheinparadigma von Hintergrund und Vordergrund wird selbst zum Schein. Hintergründe verschwinden und das Nichts taucht an ihrer Stelle auf (Flusser, Lob der Oberflächlichkeit, S. 328). Kollabiert aber in der Digitalisierung von Hintergründen und Vordergründen das Wahrnehmungsfeld als Ort der Gegenstände, ist nichts mehr wahrzunehmen. Wir erleben nur noch Rauschen, Flimmern, eine Drift der Entphänomenologisierung. Alles ist gleichermaßen Oberfläche, die jeden Gestus auf das Verschwinden seines Wahrnehmungsfeldes bezieht. Eine "Theorie der Praxis" würde an der Praxis irre werden, die ohne Zugriffsmodus bleibt, weil es letztlich nichts mehr wahrzunehmen gibt. Es entsteht die Situation eines permanenten Vorgriffs, der sich fatal auf freiheitsorientierte Gesten auswirkt, weil diese in der Zeit erst geformt werden müssen. Jede aufgeklärte Geste käme zu spät, weil ihre Fixierung den rasenden Wahrnehmungsfeldern widerspricht. Mobilität als Wahrnehmungsfalle heißt: Das Neueste wird zum phänomenologischen Tod des Neuen. Danach stoßen unabgeschlossene Projekte, in deren Postulat sich nicht nur Phänomenologen, sondern alle evolutionäre Diskurse treffen, auf entwicklungsgeschichtlich heißlaufende Wahrnehmungsfelder. Das in der Geschichte Unabgeschlossene wartet nicht länger auf seine Erlösung. Beschleunigung, die vielleicht nur für Menschen in rasendem Stillstand endet, spottet dem Gegenwartsbewusstsein, so zukünftig es sich auch gerieren mag. Vorformen dieser Erhitzung von Wahrnehmungsfeldern beobachten wir etwa in rezeptiven und interaktiven Gesten, zapping, surfen etc., die ja keine gesicherte Phänomenologie des Gestus besitzen, sondern als phänomenologische Flüchtigkeiten beschrieben werden müssen. Das ist aber nicht lediglich ein Gestus, der in Flussers Begriff auf seine Vollkommenheit umgestellt werden könnte, also Freiheit ermöglicht, sondern ein in den Wahrnehmungsfeldern sich selbst vollziehendes Geschehen. In der phänomenologischen Drift wanken nicht nur Weltbilder, sondern Wahrnehmungen finden nicht mehr statt, weil sie ohne Objekt bleiben. Flusser konstatiert selbst, dass die Welt nicht mehr opak ist, sondern durchsichtig geworden sei: "Und die Fackel, die sich selbst entdeckt hat, hat nichts mehr zu beleuchten" (Flusser, Lob der Oberflächlichkeit, S. 326). Wenn aber nichts mehr zu beleuchten ist, scheitert auch jede evolutionäre Welterschließung. Solche Asymmetrien medialer Welterschließung als phänomenologische Schwäche wachsen aufgrund exponentieller Entwicklungsgeschwindigkeiten. Allein eine Oberflächenbegegnung mit dem Internet bestätigt diese Antiquiertheit von Gesten gegenüber veränderten Medialisierungen. Die Präsentation von websites, Interaktivitätsdefizite, passive Rezeption, Abbildung, aber auch soziale Modi behandeln dieses Medium wie ein mixtum compositum aus Telefon, Fernsehen und Briefpost. Das ist keine Schwäche der phänomenologischen Justierung auf einen neuen Standard, die Suche nach dem adäquaten Gestus, sondern das Phänomen der Entphänomenologisierung medialer Gesten, überdeutlich in der wuchernden Asymmetrie der Teilnehmerhandlungen. Gegen den Phänomenologieverlust könnte sich der Einwand richten, dass Phänomene in der Welt bleiben, ihre Selbst- und Fremdvermittlung bei jeder Konstruktion vorausgesetzt wird. Aber unsere eigenen epistemologischen Löcher belegen, dass technischer Fortschritt diese Hindernisse zugleich beseitigt wie vergrößert. Die ungelöste Bestimmung von Medien als Werkzeuge oder als Subjekte lässt gerade nicht den Schluss zu, dass sich Phänomenologien zu einer gesicherten Erkenntnis der Medienontologie noch schließen lassen. Die radikale Demontage dieser phänomenologischen Geschlossenheit beobachten wir heute. Solche Fixierungen der Apparate sind in Zukunft nicht mehr wahrscheinlich, da die technologischen Entwicklungsschritte immer kürzer werden und exponentielle Entwicklungsschritte Phänomenologien ausradieren. Da Phänomenologie von der Stabilisierung eines Entwicklungsschritts abhängig ist, werden phänomenologische Medienbetrachtungen lediglich zur Retrospektive nicht wahrgenommener Gesten. Gesten, wie sie Vilém Flusser untersucht, werden sich nicht länger fixieren. In den medialen Evolutionen beobachten wir eine Entphänomenologisierung unseres vermittelten Weltverhältnisses. Dieser Prozess bestreitet zum wenigsten die Möglichkeiten einer Universalisierung medialer Entwicklung, aber "Gesten" als menschliche Zugriffsweisen verfallen zu historischen Phänomene. Menschheitsdämmerung... Goedart Palm (Porträt des Autors: siehe unten) |
|
|