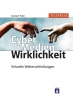|
|
Liter@tur im Netz Ein Vortrag mit Demonstration Gehalten am 23.09.2000 im Komed/Media Park, Melanchthon Akademie, Köln |
Einleitung 1. Einem zweifelhaften Gerücht zufolge soll sich Sophokles beim öffentlichen Vortrag einer langen Passage seiner "Antigone" zu Tode gelesen haben, weil der Text mangels Interpunktion keine Pause zuließ. Ein schöner Tod! Weniger Zweifel an dem Wahrheitsgehalt dieser Schlussepisode eines unsterblichen Dichters kämen auf, wenn Sophokles Surfer gewesen wäre, weil in den "zwischennetzlichen" Beziehungen inzwischen auch ohne die Gnade von Interpunktion, Zäsur und Maß agiert wird. Das literarische Internet präsentiert sich heute als wildwuchernder (Kon)Text aus Texten. Unzählige Autoren schreiben an diesem Megatext und nie wird ein Mensch diesen babylonischen Text je vollständig lesen. Das Netz ist selbst ein alphanumerischer Text und seine literarische Bedeutung hängt vom Erkenntnisinteresse ab. Zu Recht ist darauf hingewiesen worden, dass die Schönheit eines Virenprogramms über die Erlesenheit solcher Texte hinausgehen mag, denen wir auch in Zeiten postklassischer Beliebigkeit und Unübersichtlichkeit noch das Attribut "literarisch" beimessen würden. 2. In der babylonischen Architektur des Internets finden sich zunächst immer umfassendere Literatursammlungen - das ist alter, aber guter Wein in neuen Schläuchen: Das Projekt Gutenberg - Deutschland mag die bekannteste Sammlung klassischer Texte sein, die urheberrechtsfrei sind, und daher jedermann zum Sofortverzehr oder download präsentiert werden. Auch wenn diese Projekte hier nicht detailliert verfolgt werden, ist immerhin festzustellen, dass teilweise sehr schöne Sammlungen entstanden sind und bei Gutenberg.de die Zugriffszahlen pro Monate angeblich in Millionenhöhe liegen. Eine ebenfalls sehr gelungene, wenn auch viel kleinere Sammlung präsentiert Hans-Heinrich Fortmann: Deutsche Gedichte - Homepage Hans-Heinrich Fortmann. Auch wenn die Netzavantgarde das mitunter als "Literatur im Netz" gering schätzt, gleichsam als Text im Behälter abtut, werden auch hier Rezeptionsmöglichkeiten gefördert, die über den Lektürekomfort des Printmediums weit hinausgehen. Welche Print-Bibliothek verfügt über solche Speicher und Suchfunktionen? Wenn hier von "Literatur im Netz" die Rede ist, wollen wir aber solche Literaturprojekte betrachten, die versuchen, dem Medium eine eigene Literatur abgewinnen. (Wer im Übrigen eine Einführung sucht, kann sie bei: Dieter E. Zimmer: Die digitale Bibliothek (zur zeit down) sowie Berliner Zimmer finden.)
1. Die Hoffnung, das kommunikativ revolutionäre Medium "Internet" habe auch eine revolutionäre "Netzliteratur" als neue genunine Literaturgattung vorgestellt oder gar große Kunstwerke geschaffen, hat sich trotz der ausufernden Produktivität bisher nicht eingelöst. Dieser Tatbestand könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Netz trotz seiner technischen Möglichkeiten letztlich die Literatur unberührt lässt, die neuen Möglichkeiten der Textproduktion noch nicht völlig erschlossen sind oder aber die Leser diese Texte noch nicht richtig lesen können. Fraglich ist, welche Veränderung das Medium "Literatur" durch digitale Medien, allen voran das Internet, erfährt. 2. Genuine Netzliteratur dürfte darin erkannt werden, dass entweder literarisch-technologische Veränderungen der Textualität nur im Netz möglich werden oder/und das gesellschaftliche Umfeld der Texte sich auf die spezifische Technologie des Internets stützt. Wer Netzliteratur nur darin sieht, dass sie allein im Netz stattfinden kann, also nicht auf Printmedien, CD-Roms oder irgendein anderes Medium übertragbar ist, wird die folgenden Exkursionen zum größten Teil nicht für spezifisch halten. Literaturwissenschaftler suchen Kategorien, es stellt sich große Befriedigung ein, wenn viele Schubladen viele trennbare Phänomene beinhalten, die den horror vacui beruhigen und so lässt sich immer wieder ein Bemühung erkennen, die Besonderheiten der Internetliteratur gegenüber anderen Literaturen festzuhalten. Florian Cramer verwehrt sich etwa gegen die naiven Freiheitsverheißungen von Hypertextualität und Multimedialität. So sei die Geschichte der Netzdichtung eine Geschichte konzeptueller Missverständnisse, weil nicht realisiert werde, dass das Netz selbst einen Code hat, den zu beeinflussen dessen spezifische Literatur sei. Sollten die meisten Netzliteraten letztlich doch noch antiquierten Konzepten folgen? Mag sein. Wer wie Florian Cramer einen puristischen Ansatz verfolgt, der das Etikett "Netzliteratur" nur für das im Netz zu Realisierende reserviert, wird "in der Kontamination von natürlicher Sprache und Programmiersprachen....das größte Potenzial künftiger Netzdichtung" erkennen. Cramer erinnert daran, dass "die Avantgarde des Schreibens in Computernetzen bislang nicht Schriftsteller, sondern Programmierer (waren), die das Internet und seine Unix-Software geschrieben haben." Cramer verweist etwa auf die australische Netzdichterin mez alias Mary Ann Breeze mit Texten, die den Slang von Computercrackern mit Joyce´scen Sprachspielen kombinieren. Weiterhin nennt Cramer die sog. Perl Poetry, eine in Programmiersprache verfasste Netzlyrik, deren Programmcode auch als Lyrik goutiert werden mag. Ein Beispiel – vom Vortragenden garantiert falsch rezitiert - lautet etwa: #!/usr/bin/perl sleep; pipe (drip, drip); listen (drip, drip); kill noises; kill dripping; close pipe soon, NOW; sleep again; listen (drip, drip); sleep (not now); exit (do it); accept destiny, now; alarm neighbors; get the keys now, & #open (up, &survey the); crypt of,darkness; not a single; pipe here,anywhere; Obzwar Cramer in seinen neun Thesen herausfinden will, "Warum es zu wenig interessante Netzdichtung gibt" erscheinen mir die von ihm gegebenen Beispiele einer genuinen, aber ebenso raren wie esoterischen Netzliteratur letztlich nichts anderes zu sein als der Versuch einer Antwort auf die Frage, ob jenseits menschlicher Poesie eine Maschinenpoesie denkbar ist. Auch wenn man diesen Glauben mit guten Gründen besitzen kann, bleibt die Frage, ob Menschen in Zukunft noch die geeigneten Rezipienten dieser Art von Literatur/Poesie sind. Einen Reiz solcher Sprachspiele auf der Ebene des Programmiercodes mag bestehen, aber mir scheint es falsch, den Code gegen das Symbolsystem "Sprache" auszuspielen, wie immer auch diese Sprache technisch generiert wird. Das wäre etwa so, als würde man das menschliche Sprachvermögen auf die zu Grunde liegenden physiologischen Prozesse zurückführen und in deren Betrachtung auf die Sprache des Menschen schließen. Was für das Programm oder den Code signifikant ist, avanciert dadurch noch lange nicht zum Signifikanten oder Signifikat einer Literatur, die bei aller Verschiedenheit ihrer Anlässe ihre Gemeinsamkeit in der menschlichen Sprache findet. Aber das Spezifikum der Netzliteratur ist nicht nur der Code, sondern auch die virtuelle Gesellschaft, in der sie entsteht. Das Netz ist in seiner Struktur ein konnektives, interaktives Medium mit einer gesellschaftlichen Potenz, die wir bisher nur in ihren Anfängen erkennen. Es verknüpft auch das, was nicht zusammengehört. In diesem sozialen Ambiente entstehen auch solche Literaturen, die zwar in andere Medienzusammenhänge übertragbar wären, aber ihre Geburt, ihre Ausstrahlung und ihre Bedeutung im Netz erfahren haben. Insofern sind die Entstehungsbedingungen solcher Literatur, wenn auch nicht ihre technologische Realisation, netzspezifisch. II. Vom Gesamtkunstwerk zum Hyperkunstwerk Die permanente Beschwörung der mit dem Netz aufgerüsteten Multimedialität bietet zunächst aber auch wenig formale oder inhaltliche Aspekte, ein Kunstwerk zu schaffen, das über das klassische Symbolsystem der Sprache und die mehr oder weniger weit reichenden Formalisierungen der Literatur hinausgehen würde. Die Aufrüstung mit Bildern, Animationen und Tonspuren verspricht vordergründig zwar das medial integrative Kunstwerk, meinetwegen mag vom Gesamtkunstwerk sprechen, aber das ist kein literarisches Kriterium, sondern nur eine mediale Beschreibung von Möglichkeiten. Wer hier ein poetologisches Modell sucht, wird zum ehestens von einer technologischen Literarizität sprechen, in der die Technik der Literatur auf die Sprünge hilft. Was heißt das? III. Dichtende Maschinen 1. Eine noch kuriose, aber in Zukunft mit hohen Erwartungen verbundene Textproduktion, die vornehmlich technologisch ausgelöst wird, sind Textgeneratoren wie etwa Gedichtmaschinen: Chris Seidel`s Poetry Generator, Poetron4G - Günters Genialer Gedicht Generator, Lyrik-Maschine von Martin Auer. Streng genommen handelt sich hier in der Tat (oder im Wort) nicht um Internet-Literatur, sondern um Textgeneratoren, die mit mehr oder weniger gelungenen Algorithmen und semantischem Material Texte hinter - in einigen geglückten Ausnahmen - auch vor dem Horizont der Willkürlichkeit entstehen lassen. Hinter diesem Phänomen verbirgt sich die offene bzw. umstrittene Fragestellung, ob es Literatur jenseits menschlicher Kreativität gibt. Semantische Ausstattung, Random-Faktoren, Komplexität des poetischen Codes wären Kriterien für die Qualität dieser Literatur. Die Frage der literarischen Potenz solcher Maschinen beantwortet sich aber letztlich allein in der Lektüre. Poetron4G etwa gelingt es mitunter auf Grund von vorfabrizierten und vom "Urheber" beigesteuerten Textelementen Gedichte zu machen, die sich im Nebel surrealer Poesie verlieren und hier und da ein wenig Erstaunen oder gar Sinnerleben beim Leser hervorrufen mögen. Doch auch jenseits dieser bedingten Einflussnahme des Leser/Autors von Texten poetischer Generatoren gibt es auch nichtmenschliche Textproduzenten wie etwa Brutus, der in seinen Kurzgeschichten das Thema Betrug variiert. 2. Wenn das Misstrauen gegenüber dem hirnlosen Textproduzenten zurzeit noch seine Berechtigung haben mag, könnte diese Entwicklung eine ähnliche Verlaufsform finden, wie sie etwa bei Schachcomputern zu beobachten war. Das glaubt zwar niemand, der den menschlichen Faktor für eine nicht in Maschinensprache auflösbare Größe hält, aber auch Literatur folgt Regeln, so komplex und unnachvollziehbar sie auch zurzeit noch erscheinen mögen. IV. Digitale Collagen Nicht netzspezifisch im strengen Sinne, aber im Netz vielfach zu finden, sind digitale Text/Bild-Collagen. In Zeiten, in den die literarische Welt auf "copy und paste" hin ohne Mühe unendliches Collagenmaterial bereithält, schlägt auch die Stunde des Collagenromans erneut. Heute muss niemand mehr abschreiben, keiner muss wie weiland Max Ernst mit feiner Schere in endlosen Stunden das Material präparieren, bis es sich in die formale Fantasie des Autors einpasst. Wer also wie der Vorvater des Surrealismus, Lautreamont, von der Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Vivisektionstisch träumt, findet im Netz seine Visionen immer wieder neu bestätigt. Unter http://www.softmoderne.de/SoftMo99/glaser/index.htm
präsentiert etwa Peter Glaser den Roman "Licht, Berlin", in dem er sich ein
Stelldichein mit den Autoren Walter Benjamin, Peter Handke, Marshall McLuhan gibt. Dieser
Text hat diverse Zugänge, sodass man in den Inhalt nach Anfängen (A - Z) Ein weiteres Beispiel für einen Collagenroman, der sich zugleich diversen Bildmaterials versichert, ohne einen Lektüremittelpunkt zu forcieren, findet sich bei Michael Rutschky "Berlinroman" - eine Arbeit, die sich m.E. nicht wesentlich von den Arbeiten unterscheidet, die Rutschky vor den Netzzeiten präsentiert hat. V. Multiperspektivität 1. Die Architektur des Netzes folgt einer paradoxen Verräumlichung. Räume werden dynamisiert, stehen gleichweit entfernt - jederzeit bereit, sich zu virtuellen Szenarien zusammenzuschließen. Kaum lässt sich eine diskrete Trennung der Räume von der Temporallogik des Netzes trennen. Fast scheint die Relativitätstheorie sich mit ihrem Wissen von der Verschmelzung von Raum und Zeit auch als Makrotheorie des Netzes anzuempfehlen. So ist das Netz weder zeit- noch raumlos, aber es inszeniert Architekturen und Zeitschemata als fiktionale Beruhigungen der user, die hier eine Heimat suchen, die zumindest ein wenig "Netzwärme" spenden soll. Mit einem Wort: Das Netz ist unübersichtlich und auch Suchmaschinen und ähnliche Zusammenfassungen von "content" lassen den fröhlichen surfer oft vergeblich um Orientierung kämpfen. Wer hier wenigstens noch den Rest eines Überblicks über neueste Tendenzen sucht, Literatur etwa in den umfassenderen Rahmen der Kultur des Netzes stellen will, findet anspruchsvolle Aufklärung bei Hotwired und Telepolis – für beide Namen gilt: est omen. Telepolis ist kein reines Kulturmagazin, sondern ein Forum für netzspezifische Themen, das längst deutlich gemacht hat, dass es ein virtuelles Leben nach oder mit dem realen gibt. 2. Multiperspektivität als Fortsetzung der Literatur mit den Mitteln des Internets findet man dagegen, aber auch hier gilt wie für viele Projekte, fand man in dem Werk "Die Aaleskorte der Ölig" (down): Dieses Projekt präsentiert eine Geschichte, die durch den Leser variiert werden kann: Die Vorlieben oder Motive des Lesers werden zumindest tendenziell zum Steuerungsmoment der Erzählperspektiven. Ähnlich eröffnet "Looppool" (down) Variationsmöglichkeiten des Rezipienten über einen Popsong. Das Projekt C.O.R.E. simuliert einen "Computer im Computer", der eine Szene aus dem Film "Casablanca" zu immer absurderen Konstellationen abwandelt, ohne dass die Lust daran zu einer schlüssigen Semantik aufschließen würde. Ein typisches, mit viel Lob begleitetes Beispiel einer topografischen, multiperspektivischen Bildtextgeschichte findet sich unter http://www.teleportacia.org/war/- (http://www.cityline.ru/~olialia/war/) – Die Geschichte spaltet sich in Fenster, die immer kleiner werden, bis schließlich 17 verschiedene Fenster geöffnet sind und der Name der Autorin Olia Lialina als Email-adresse erscheint. Diese Autorin hat den Anspruch Geschichten, ggf. Hunderte von Geschichten simultan zu erzählen. Dabei kommt es der Autorin auf den Rahmen, will sagen: die Rahmen an. Da wir in einer "Windows-Welt" leben, mögen Rahmen und Fenster vielleicht die stärksten Metaphern unserer Schnittstellenlebensweise sein. Im Gegensatz zu Film und Video entstehen jedenfalls so simultane, parallele, assoziative Erzähltopografien, die etwa die vermeintliche Linearität des Mediums "Buch" aufbrechen sollen. In der Tat verbindet sich mit dieser labyrinthischen Literatur, die sich im besten Sinne verzettelt und klassische Erzählhaltungen ablehnt, die plotgläubig den Leser in eine Richtung mitziehen, ein vernetzter Erzählmodus. Auch auch das Buch ist ja nur vordergründig ein lineares Medium. Wer hätte nicht auch Printtexte als multiperspektisch erfahren, auch in Büchern lässt sich surfen, wenngleich die "Regieanweisungen" des Autors eine stärkere Bindung der Lektüreeinrichtung des Lesers bedingen als vielfach verzweigte Hypertexte. Jedenfalls erscheint das genannte Beispiel noch erheblich verbesserungswürdig zu sein, insbesondere weil das verwendete Material sehr beliebig eingesetzt wird. Das Werk mutet wie ein Comic an, der zwar lernt, in verschiedene Richtungen zu laufen, d.h. einige Schritte zu tun, aber Textfetzen und nicht auslotbare, weil narrativ nicht ausformulierte Figurenkonstellationen bieten dem Leser oft nur assoziatives Material. Das Problem des Netzes und auch der Netzliteratur ist im Übrigen zuletzt der Mangel an assoziativen Schnittstellen. Die Synapsenfreudigkeit präsentiert inzwischen nicht nur eine literarische, sondern eine allgegenwärtige multithematische Aufdringlichkeitskultur, während der Leser gerade im Verlust eines literarischen Gravitationszentrums Verbindlichkeiten, Regieanweisungen etc. sucht. 3. Einen Schritt weiter geht Olivia Adler mit ihrem begehbaren Roman. Die Autorin stellt dazu fest: "Der Beitrag hat sich unter dem ständigen Feed-back der Leser von seiner ursprünglichen Form wegbewegt und eine Art Evolution durchgemacht. Die Zeitleiste am oberen Rand ist das zentrale Navigationselement, der Text ist immer der gleiche, das erste Kapitel eines Romans, der offline entsteht und für den ich im Dezember 1997 die cafe-nirvana.com Domain reservierte, um einen Teil der Geschichte im Netz wahr werden zu lassen. In diesem Roman geht es um das Internet im Jahr 2044, um künstliche Intelligenz, Virtual Reality und die Frage, inwieweit virtuelle und greifbare Realität noch voneinander unterschieden werden können...Es wird nicht mehr einfach nur gelesen, sondern Rätsel müssen gelöst werden, der Text wird mit Illustrationen und Tönen aufgelockert, eine Kreuzung zwischen Computerspiel und Comic, das aber seine textliche Herkunft nicht verleugnen kann. Interaktivität gibt es in Form von Chat, Messageboard und der Möglichkeit, dem Autor per e-mail oder Formular Feed-back zu geben. Die Geschichte wird nicht mehr erzählt, sie findet statt - im WWW. Die chronologische Reihenfolge ist aufgebrochen - der Leser wird zum Detektiv auf Spurensuche, deshalb ist der Ausgangspunkt auch eine Abfrage in einer Suchmaschine. Die Geschichte hat sich bereits ereignet, und der Leser recherchiert. Die Figuren haben sich verselbstständigt. Sie haben Homepages, sie schreiben e-mails, sie verewigen sich in Gästebüchern und Foren, und sie werden von Suchmaschinen gefunden. Natürlich ist diese Suchmaschine nur ein Fake, aber wenn die Seiten nur lang genug im Web wären, würden sie früher oder später tatsächlich in den Listings von Suchmaschinen auftauchen... Natürlich haben diese Charaktere kein Eigenleben, der Autor steht immer als Puppenspieler dahinter. Noch sind wir nicht so weit, dass wir KI's ins Web schicken können, die ihre eigenen Seiten bauen, ihre eigenen Mails schreiben und sich selbst weiterentwickeln. Aber wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Die Geschichte ist Realität geworden." Auch wenn hier Anspruch und Realisation nicht deckungsgleich sind, ist dieser Ansatz vor allem deshalb so interessant, weil die Erzählung nicht mehr als ein abstraktes Symbolsystem entsteht, das eben gelesen werden muss und nur im Bewusstsein des Lesers den Figuren ein Sein verleiht. Hier entsteht ein narrativer Raum, eine Erzähltopografie mit Akteuren, die sich potenziell verselbstständigen. Die fiktiven Figuren, die Helden treten aus dem Rahmen der auktorialen Festlegung hinaus und beginnen ein Eigenleben zu führen. 4. Einen sehr ähnlichen Anspruch verfolgen auch die sog. MUDs (Multi-User-Dungeons, Multi-User-Domain, Multi-User-Dimension), die einer großen Anzahl von Spielern die Beteiligung an einem Spielszenario eröffnen, in dem sie zu "personae" werden, dh. sich Masken aufziehen und etwa mittelalterliche Barden oder Helden werden. Das ist in unserem Zusammenhang deshalb bemerkenswert, weil sich auch hier der Mythos aus der Erzählform löst, dramatisiert werden kann und sich multiperspektivisch fortspinnt, ohne einem "plot" zu folgen. Hier wird Cyberspace zur literarischen Bühne, die Mitspieler kommunizieren über die von Ihnen im Rahmen des "dungeons" eingerichteten Räumen und vor allem Texten, die mehr oder minder literarisch sind. Sherry Turkle berichtet immerhin von Hochzeiten und intimen Begegnungen in Cyberspace, die auf Grund der Rollenprofile den Usern mitunter Erlebnisstoff bieten, den sie in "Real Life" nicht hätten. Wie hier, aber auch an zahlreichen anderen Stellen im Netz auffällig ist, treten viele User mit Fantasienamen, Pseudonymen, konstruierten und fabulierten Identitäten auf, führen eine zweite, dritte, ja multiple Existenz oder entscheiden sich für virtuelle Travestien, dh. ändern sogar ihr Geschlecht. Hier werden künstliche Identitäten hergestellt, die im Cyberspace einen Anspruch auf Eigenleben reklamieren, mitunter aber auch Ausgänge in die "wirkliche Wirklichkeit" haben. Vor kurzem wurde etwa die Mailingliste Netzliteratur durch einige Teilnehmer verunsichert, die sich unter Leihidentitäten eingeschmuggelt hatten, und von denen einer sich als alternder Nazi auswies. Die damit verbundene Konfusion ist exemplarisch in dieser Welt der Kürzel und Täuschungen, sodass sich auch hier literarische Stoffe einleiten, die zwar klassische literarische Provenienzen haben (Romantiker mit ihren Doppelgängerfantasien), aber doch in Digitalien in viel umfassenderer Weise virtualisiert werden kann. In der Folge sind eben auch Szenarien denkbar, in denen sich Idee und Figuren von ihrem Schöpfer lösen und eine virtuelle Realität produzieren, die auf Grund der bedingten technologischen Möglichkeiten zwar noch reduziert gegenüber unserer Ausgangswirklichkeit erscheint, mit Sicherheit aber in der Folge die Fantasien immer lebendiger – im wahrsten Sinne des Wortes – werden lassen. Allerdings hebt sich diese Literatur idealtypisch zuletzt selbst aus, weil sie nicht mehr eine Beschreibungsebene der Welt, sondern selbst Welt sein will. Der Leser ist keiner mehr, er wird zum Akteur unter Figuren, die eigene Wege gehen und die Geschichte ist auch keine mehr, weil sie erst im Handeln entsteht. So weit sind wir zwar noch nicht, aber hier wird besonders deutlich, dass die Literatur in zukünftigen Hypermedien ins Leben, auch wenn es zunächst nur als virtuelles reduziert erscheint, zurückgestoßen bzw. erhoben wird. VI. Hypertext 1. Hypertext ist zunächst nichts anderes als getrennte, mehr oder weniger selbstständige Texte durch sog. Hyperlinks zu konnektieren. Ihre Lektüre erfolgt durch Browser, also Softwareprogramme, die eine Schnittstelle zwischen Text und Leser herstellen. In diesem Sinne ist das Netz selbst ein Hypertext. Bekannte Hypertextprojekte, die dieses Strukturmoment literarisch nutzen und zugleich auch diverse Theorien dieser Textweisen präsentieren, finden sich bei Eastgate, Mark Amerikas Grammatron und den Hypertext-Experimente des Florida Research Ensemble. Ein Klassiker ist bereits Michael Joyces Afternoon (Vgl. unter Eastgate). Fließend ist hier mitunter der Übergang zu Hypermediadokumenten, die zugleich auch Abbildungen, Ton, Filme und Animationen verarbeiten. So können Seiten etwa durch dynamische HTML-Effekte so präpariert werden, dass die Texte in einer bestimmten Weise aufladen – etwa einfliegen oder sich langsam auftragen – bei der Berührung von Texten oder Bildern sich unter den Augen des Lesers verändern. Hier lässt sich zum ehesten von einer Taktilität des Textes sprechen, der gegenüber klassischer Literatur eine neue Wahrnehmungsebene schafft. Im Übrigen lassen sich digitale Texte ohnehin durch Suchfunktionen auch jenseits der Autorenvorgaben hypertextualisieren. 2. Die Verweisungsphänomenologie des "Hyperlinks" in der literarischen Arbeit ist m.E. noch wenig erschlossen, obwohl die literarischen Vorläufer diese Technik längst erkannt haben, wenngleich sie diese Konstruktion noch nicht technisch realisieren konnten. Bereits ältere Autoren wie etwa Sterne haben narrativ geschlossene Strukturen in Frage gestellt und dem unabgeschlossenen Text, der nichtabschließbaren Erzählung mehr Wahrheit beigemessen – das zeigt etwa Sternes Erzählstruktur der ständigen Abschweifungen, Aufschübe und scheinbar unvermittelten Einfälle. Aber selbst die über Jahrhunderte ausgedehnten Redaktionskollektive diverser Weisheitsbücher erscheinen selbst als Paradigma der Unabschließbarkeit des Mythos, seiner Veränderlichkeit und Relativierungen im Lauf der Reproduktion. Jede Fiktion eines geschlossenen Textes bestreitet sich selbst in kollektiven Redaktions- wie Rezeptionsgeschichten, sodass Umberto Eco zu Recht vom offenen Kunstwerk sprechen konnte, das sich immer wieder neuen Lesarten stellt. Die frühe Literatur des 20. Jahrhunderts, etwa Joyce, Döblin, aber auch Thomas Mann, später die Protagonisten des noveau roman oder Arno Schmidt, haben diese Form der Intertexualität ausgebaut. Hier wurde mit unterschiedlichen Experimentierlüsten eine Vielzahl von Textsorten vorgestellt, die der Konstruktion von Collage, Montage bzw. parafilmischen Schnitttechniken folgten. Diese Techniken entsprangen nicht nur der Adaption anderer künstlerischer oder technologischer Konstruktionsformen, sondern folgten einer tiefen Verunsicherung gegenüber Schließungen, Einheitsprinzipien, Weltbildern und allen übrigen Formen klassischer Selbstverteidigung gegen eine Komplexität, die nicht mehr in der reduktiven Textproduktion verarbeitet werden kann. Vereinfacht: Versagen Ideologien oder idealische Muster der Welterschließung, bricht auch die Form auf. Geschlossene Formen werden dann oft zu Abfallproduktionen, die den Trivialkünsten vorbehalten bleiben. Nun sind aber selbst die trivialen Geschichten in cyberspace oder in der neuen software längst zu infiniten Geschichten mutiert, die nicht länger auf Geschlossenheit zielen. Es wächst jetzt auch das zusammen, was nicht zusammengehört. Auch wer gegenüber Korrespondenztheorien der Literatur, der relativen Spiegelung von Welt und Text skeptisch ist, wird nicht die Wirkungsmacht solcher Bodenverluste auf Literatur abstreiten können. Von der Inflation des Romans als der Form der Formlosigkeit bis hin zur heute grassierenden "Hypermania" wird die Hoffnung auf einen archimedisch festen Punkt der Weltenthebelung vereitelt. 3. "Hyperlinks" sind danach nicht nur die vorläufige Hochform der künstlerischen Montage im Internet, sondern "bodenlose" Fortbewegungsmittel, die unausweichliche Exkurse, autonome Schnittstellen der Rezeption, Abschweifungen und Aufbrechungen der Form zum beherrschenden Konstruktionsprinzip einer Literatur werden lassen, die eben keinen Formkanon mehr besitzt. Ein weniger anspruchsvoller, aber sehr sinnvoller Einsatz des Hyperlinks sind aber gerade solche Verweisungssysteme, die eben Literaturhinweise, Fußnoten oder Wissenshintergründe vermitteln, ohne den eigentlichen Text zu befrachten. Längst ist im literarischen Netz jedenfalls eine Selbstbescheidung der Autoren zu beobachten, Hyperlinks vorsichtiger einzusetzen. Weitere Informationen zum Thema: Hyperfiction Linkliste. VII. Work in progress/Kollaborationen 1. Hypertrophische Texte Geschichten, die nie zu Ende gehen, scheinen auf Internetautoren einen mächtigen Reiz auszuüben. Hier spiegelt sich die unabgeschlossene und unabschließbare Struktur des Netzes in der literarischen Erzählweise. Jede Lektüre ist in ihren Konnotationsmöglichkeiten an die Textverfestigung, den Verlauf und das Ende einer Erzählung gebunden. Aber es gibt auch medial-technische Gründe: So stößt das Buch sehr schnell an die Grenze des Mediums – kiloschwere Werke wie etwa "Zettels Traum" von Arno Schmidt sprengen das Printmedium. 1.Ein Medium, das dagegen über gewaltige Speicherkapazitäten verfügt, verleitet dazu, auch diese Grenzen der Textverfassung aufzubrechen, wie die etwa immer höherragenden "Die Säulen von Llacaan". Dabei handelt es sich um eine Narration, die drei Anfänge und mehrere Fortsetzungen der Auswahl des Lesers zur Verfügung stellt. Sollte in dieser Struktur der Leser seine Wunschlektüre nicht finden, kann er selbst eingreifen und dem webmaster seine Lektüre, die zugleich Text ist, vermitteln. Davon wird offensichtlich rege Gebrauch gemacht. Der Leser begegnet nicht mehr einem linearen Inhaltsverzeichnis, sondern komplexen Baumstrukturen, die entsprechend vielfältige Zugangsweisen eröffenen. Hier wird zugleich klar, dass das Netz eine wuchernde Topografie ist, die in ihrer Virtualität auch das Wunschdenken von usern zu befriedigen verspricht. Zwar sind die vielen "bugs" und "broken links", die auch den Vortragenden bei der Vorbereitung quälten, sowie unerträgliche down- und upload-Zeiten noch ein Riegel vor der endgültigen virtuellen Herrlichkeit, aber wie die Werbung weiß: Man arbeitet daran. Weiteres Beispiel für alternative Handlungsverläufe "Zeit für die Bombe". 2. Vielleicht das prominenteste Beispiel einer Geschichte in Entstehung ist: Novel in Progress: MARIETTA von Matthias Politicky (down?). Politickys Schreibforum kann zwar gleichsam in Echtzeit betrachtet werden, ist aber nur vom Schriftsteller zu betreten. Interessant ist hier die Entstehung und Verknüpfung des Werks zu sehen, das eine Fortschreibung des "Weiberroman" von Politicky ist. Daneben existiert eine Parallelforum, auf dem sich mehrere Autoren eigenen Fortsetzungen des Romans widmen. Auch Netzbesucher können hier ihre Vorschläge und Fortsetzungsideen präsentieren. Politickys Projekt hat viel Resonanz – bis zu 10.000 pageviews im Monat - , aber der Schriftsteller äußerte Zweifel, dass das Werk überhaupt gelesen wird, weil surfer zumeist Zeitgenossen seien, die Ablenkung und nicht Kontemplation suchen. Aber auch hier hat die vormalige Euphorie Polityckis über die Koautoren "Zehn User haben regelmäßig mitgeschrieben. Wahnsinn, was dabei herauskommt" nicht lang gehalten. Politycki hat mitnichten diese Ideen, etwa eine uneheliche Tochter seines Romanhelden, akzeptiert, sondern die "Userkiste" (Der Spiegel Nr. 38, 18.09.2000, S. 243) wieder ausgeräumt und letztlich doch "Ein Mann von vierzig Jahren" selbst geschrieben. 3. Aber es geht auch anders. Die Rollenveränderung des klassischen Autoren-Leser-Verhältnisses wird durch die technische Vereinfachung markiert, gemeinsam, ja in großen Gruppen Fließ- oder Wandertexte digital zu schreiben. Der Leser als Autor findet sich auch in Kooperationsprojekten wie: Add-venture, Hyperknast, Claudia Klingers Human Voices - Texte aus irgendwo. Die klassische Autorenfunktion wird zu Gunsten einen offenen Autorenzusammenhangs verwischt, dem sich der einzelne Teilnehmer mehr oder weniger ein- und unterordnet. Die Hypertextualisierung in diesem Fall ist nicht nur technisch bedingt, Texte hinter einander zu montieren, sondern auch die Kommunikationserleichterungen zwischen den Autoren per email oder auf elektronischen Foren führen eine weitere Ebene des Hypertextes ein. Hier wird das vormalige "Textzentrum Autor" zu Gunsten einer polyfonen Textlichkeit zerstört, deren Urheber ein mehr oder minder anonymer brainpool ist. Literatur wird zum open-source-Projekt, das keine klaren Ränder mehr hat, weil die Textebenen auch in öffentliche oder private Emailkorrespondenzen und Foren hineinreicht. Zwar ist auch der traditionelle Autor durch Fanpost erreichbar, aber die ungleich rasantere Verbindung, die nicht nur durch Email, sondern auch durch Foren, newsgroups und Mailing-Listen gelegt werden, führt zu einem neuen Selbstverständnis des Lesers. Die Geschichte wird exhibitioniert, der unmittelbaren Kritik anheim gestellt. Leser greifen ein. Das bekannteste Beispiel für eine solche Newsgroup ist de.alt.geschichten, aber auch etwa bei Yahoo gibt es elektronische Kaffeekränzchen mit teilweise bizarren Themen. Hier findet eine unaufhaltsame Rollendiffundierung statt, in der der Leser zum Autor wird wie umgekehrt. Die getrennten Rollen der Autoren und Leser werden nachhaltiger erschüttert als es bisherigen litarischen Formen je möglich war. Der Leser, ohnehin jeder Rezeptionsästhetik nach ein Koautor, emanzipiert sich nun über die auktorialen Maßgaben des Textes hinaus zum Produzenten seines eigenes Textes. Wer digital liest, seine elektronischen Spuren im Netz hinterlässt, schreibt zugleich seine eigene "Hypergeschichte". 4. Viele Stimmen, die zusammen kommen, singen aber noch lange nicht im Chor, weil weder Tonart, Takt noch Rhythmus vorgegeben sind. Das "Mitschreiben am längsten Gedicht der Welt" präsentiert etwa einen poetischen Wildwuchs, der ohne zentrale Idee oder Autorenzentrum letztlich nur der Ausverkauf einer ohnedies kränkelnden Gattung ist, die allein durch den technologischen Overkill, eine ungehemmte Mitschreibelust beherrscht wird. Zumindest eröffnet sich hier aber vielleicht in Zukunft die Chance, dass sich virtuelle Autorenkollektive finden, die ähnlich den Autorengemeinschaften klassischer Literatur, wie etwa den berühmten Goncourts oder den Strugatzki-Brüdern eine Textualität entwickeln, die über das Vermögen des Einzelnen hinausgeht. Ferner: Baal lebt". 5. Einen literarisch weniger präteniösen, aber sehr konstruktiven Ansatz einer extensiven Gedächtniskultur verfolgt das groß angelegte Fortschreibungswerk Generationen-Projekt von Jan Ulrich Hasecke. Der Projektleiter will Geschichtsschreibung von unten betreiben und meint dazu: "Wie war das noch? Damals als die Mauer gebaut wurde, als der Minirock für Skandale sorgte, als die 68er auf die Straße gingen, als die RAF die Bundesrepublik terrorisierte, als Biermann ausgebürgert wurde, als Tschernobyl explodierte, als die Mauer fiel, als ..." Hasecke fordert den Leser auf, seine persönlichen Erinnerungen an wichtige Ereignisse der letzten 50 Jahre aufzuschreiben. Hier werden Geschichts- und Gedächtnisräume aufgebaut, in denen alle Formen der Literatur Platz finden sollen, von Tagebuchnotizen bis hin zu Hypertexten, sofern das jeweils geschilderte Ereignis auch Referenzen an eine kollektive Erinnerungskultur besitzt. Auch das ist sicher kein netzspezifisches Angebot, wie etwa das Auswertungsprojekt persönlicher Geschichten bei Walter Kempowskis "Echolot" zeigt. Aber erst unter den Bedingungen des Internets versprechen solche Projekte die Stollen in das Bergwerk "Geschichte" viel tiefer zu legen. Die Unabgeschlossenheit solcher Vorhaben und die potenziell unbegrenzten Speicherkapazitäten des Netzes versprechen eine Geschichtsarbeit, die tendenziell nichts mehr durch den Rost des Vergessens schicken. Aber auch hier werden Leser wie Mitschreiber mit der Frage konfrontiert, ob die Aufgabe des Literaten bzw. literarischen Historikers nicht eher darin bestünde, das Material zu sichten, auszuwählen und den Ballast zu – vernichten. 2. Kollaborationen ABSOLUT HOMER (1992) behauptet von sich, ein Unternehmen zu sein, das wahrscheinlich das gewaltigste Stück Concept-Art auf literarischem Gebiet darstellt. Der Text ist multiautorisiert, in Sprüngen stößt man jeweils auf den anderen Autor. 22 Autoren aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn und Japan übernehmen den Auftrag an Land, die Odyssee, den Beginn der nachweisbaren Autorenliteratur, an deren mutmaßlichem Ende ein weiteres Mal zu schreiben. Ausgehend von der These der Wiener Ethnologin Christine Pellech, die Odyssee sei der Reflex einer phönizischen Weltumsegelung, suchen (keine hier verfügbaren links!) Walter Grond, Elfriede Czurda, Ferdinand Schmatz, Deszö Tandori, Julian Schutting, Yoko Tawada, Patrick Deville, Ingram Hartinger, Sabine Scholl, Kurt Neumann, Hans Jürgen Heinrichs, Ludwig Fels, Lucas Cejpek, Josef Winkler, Helga Glantschnig, Jürgen Ritte, Jean Pierre Lefebvre, Günther Freitag, Angela Krauß, Ilma Rakusa und Paul Wühr die Stationen der Odyssee zwischen Sinai und den Lofoten, den Niagarafällen und Feuerland, Australien, Indien und Arabien neu auf. ABSOLUT HOMER will mehr als "die Paraphrase eines von Homer bis Joyce klassisch gewordenen Textes" sein. "ABSOLUT HOMER sichtet angeblich "die Trümmer und Scherben des Museums Europa in der Welt und erzeugt auf diese Weise ein weit verzweigtes, zum aktiven Lesen einladendes Netz von Korrespondenzen und Überlagerungen. ABSOLUT HOMER erkundet damit auch die Idee der Autorschaft unter den Bedingungen zeitgenössischer Literaturproduktion und entdeckt den Autor als Unternehmer, Manager, Archivar, Sekretär und Auftragsempfänger." Das klingt gewichtig und sagt doch wenig. Selbstverständlich bestehen zwischen Autoren Schnittstellen und wenn sie diese auch nicht selbst realisieren, war gerade die Literaturwissenschaft und – kritik immer daran interessiert, die vielfältigen, oft untergründigen Verbindungslinien der Autoren zu erkunden. Ob Homer wirklich so absolut ist, muss bezweifelt werden, mir erscheint diese Arbeit als eine mehr oder minder klassische Textsammlung mit hyperverlinkten Einsprengseln zu sein. VII. Zur Textsorte der intimen Öffentlichkeit: Digidiaries und das Seelenleben von netizens Verliert schon die politische Unterscheidung zwischen öffentlich und privat im Internet ihre Trennschärfe, so kann festgestellt werden, dass die Öffentlichkeit des Privaten keinen geringen Reiz auf Online-Autoren ausübt. Rainald Goetz, Claudia Klinger oder Paul Diel verfassen bzw. verfassten Tagebücher, die nicht länger verschlossen sind und sich erst posthum fremden Blicken öffnen, sondern eine Art instantane Lektüre fremder Befindlichkeiten, Tag für Tag, präsentieren. Diese Schreibhaltungen verdanken sich einerseits dem Glaubensverlust gegenüber der großen literarischen Form, gegenüber der Formstrenge und Vollendung, die in vergangenen Zeiten selbstverständlich vorausgesetzt wurden, bevor es einer wagte, literarisch in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Claudia Klinger etwa, die professionelles Webdesign erstellt, sagte beispielsweise, dass sie mit der Zeit auch dazu übergegangen sei, sich von der letzten Formalisierung, der gestalterischen Vollendung eines Textes zu verabschieden, um auch spontane Reaktionen zuzulassen. Rainald Goetz etwa schreibt spontan, der Leser hat fast ein Echtzeit-Erlebnis, wenn er des Autors Texte in statu nascendi erlebt. Literarische Überformungen oder Verbesserungen finden nicht statt, um die Unmittelbarkeit der Erfahrung nicht zu relativieren. Andererseits findet sich hier aber auch der mehr oder weniger versteckte Wunsch die Suche nach der verlorenen Zeit sofort und ohne Erinnerungsverluste zu betreiben. Ewigkeit, Unsterblichkeit, Zeitprotokoll sind nicht nur die hervorstechenden Momente dieser Literatur, sondern in Selbstverständnisaussagen von vielen netizens findet sich dieser Anspruch mehr oder weniger versteckt immer wieder. Aber diese Mischung aus Alltäglichkeit und Ewigkeit, Selbstverewigung und Gelegenheitsauftritten spricht weniger für die paradoxale Natur des Netzes als für die Angleichung des virtuellen und realen Lebens. Bei Goetz zeigt sich aber gleichwohl eine konventionelle Haltung des Textproduzenten, der sein Online-Werk "Tagebuch" inszwischen als Printfassung veröffentlicht hat und damit doch wieder ein Vorrangverhältnis zu Gunsten des gedruckten Buchs feststellt. Bei nicht wenigen Textiniativen ist zu beobachten, das gute alte Buch als die Krönung der literarischen Produktion vorzustellen, während die digitalen Fassungen im Netz im Blick auf große Leserkreis tendenziell reine Promotionfunktion haben. Das hängt selbstverständlich auch von der mitunter bedingten ökonomischen Verwertbarkeit der Netzfassung ab. So kann zwar über Banner-Werbung und gewerbliche Anzeigen versucht werden, auch wirtschaftliche Erfolge zu erzielen, aber der "traffic" auf Literaturseiten hält sich in Grenzen. Aber auch diese Lust der Selbstdarstellung, des Seelen-Striptease kann auch an andere Grenzen stoßen. So lesen wir auf der demontierten Homepage von Paul Diel etwa: "Paul Diel gibt es nicht mehr. Ich hatte zwar viel Spaß am Projekt, konnte aber doch nicht so frei schreiben, wie ich wollte." Sicher beschleicht jeden Autoren, der seine Intimität zur Schau stellt, irgendwann ein unheimliches Gefühl, sich freiwillig dem "Big Brother" Leser auszusetzen. Rainald Goetz hat seinen sog. "Abfall für alle" wieder in einen "Abfall für einige", d.h. die Käufer des suhrkamp-Verlags, konvertiert. Der Text ist in der Sprache der netizens "down" und so sind viele Berichte aus der Welt der Netzliteraten bereits antiquiert und was wir heute feststellen, gilt morgen schon nicht mehr. VIII. Literarische Netzkunst Literarizität gibt es nicht nur in der Sprache zu verorten. Vordergründiger gesprochen entstehen etwa mit Beginn des 20. Jahrhunderts Kunstwerke, die nicht mehr eindeutig den vormaligen Gattungsbeschreibungen der Künste folgen. Dadaisten, insbesondere Kurt Schwitters, Konstruktivisten, Futuristen, Concept-Artisten, "Konkrete Poeten", aber auch die bereits erwähnten Neo-Klassiker haben die Künste vermischt, synästhetische Eindrücke hervorgerufen und auf den Schnittlinien der Künste neue Ausdrucksformen entdeckt. Im Internet ist dieses Feld längst unübersehbar geworden und viele der bereits vorgeführten Beispiele transzendieren klassische, aber auch die noch fragilen, permanent in Frage gestellten Kategorien vernetzter Literarizität. 1. Fevzi Konuk http://www.hyper-eden.com/index.html – http://www.hyper-eden.com/digitaltroja/help5.html etwa präsentiert in "Digital Troja" einen "aesthetischen Vergleich zwischen dem 'Trojanischen Krieg' mit seinen Helden und Göttern, und den Auseinandersetzungen mit den Helden, Handys und Maschinen der Gegenwart". Der unermüdliche Dichtung-Digital-Netzliteraturkritiker Roberto Simanowski meint dazu: "In Konuks Konzept heisst es am Ende, wieder sehr klug und wieder nur dahergesagt: "Wie fängt man Wilde? Mit Tand und Glasperlen" - angesichts der glitzernden technischen Effekte und der schmucken, zumal englisch aufgepepten Headlines in "Digital Troja" fällt dieser Satz auf den Ort seiner Präsentierung zurück.....das zeigt nur, dass die von der visuellen Kunst kommenden Experimente im Feld der digitalen Literatur bei der Konzipierung des Gesamtwerkes nicht weniger durch den Tand schicker Effekte gefährdet sind als die von der Literatur kommenden; vielleicht sogar ein bisschen mehr." In der Tat. Dass das Medium und seine Ableitungen bereits die Botschaft sind, wird in der unermüdlichen medientheoretischen Nachfolge von Marshall McLuhan immer wieder festgestellt. Und viele Künstler lassen sich von den technischen Manipulationsmöglichkeiten der neuen Text/Bild-Gestaltungen mehr dazu verleiten, das Medium zu feiern, als es zu instrumentalisieren. Semantik droht hier zur Glasur der Oberflächen zu werden. In solchen Produktionen bewahrheitet sich, dass auch dann noch lange was zu sagen ist, wenn längst nichts mehr zu sagen ist. Aber auch diese Sogwirkung der Medien, ihr phänomenologisches Eigenleben reduziert sich in der Abnutzung der Effekte. Längst finden sich etwa in außerkünstlerischen Internetpräsentationen starke Tendenzen, die jeweilige Botschaft vor der Wirkungsmächtigkeit des sich selbst vermittelnden Mediums zu befreien. Immerhin tritt die Arbeit "Epos der Maschine" mit dem Anspruch auf, der zugleich die Gefahr markiert: Zwischen Text und Umsetzung werden alle Gräben geschlossen: Wörter formen sich zu Bildern, zerfließen in Gedankenströme und umschmeicheln wabernd den Machinauten, will sagen den Mauszeiger, pulsen über den Bildschirm wie manische Tagtraeume und kreisen unter anderem um den Ursprung allen Seins (http://www.uni-essen.de/~hnr00s/edmindex.html). Und weiter: "Der Betrachter taucht, die Hand an der Maus, in den Text, der ihm entgegenströmt, sich windet und verschwindet. Der Mauszeiger wird zum Großen Kommunikator zwischen Mensch und Maschine. Ersterer sitzt nicht passiv da und lässt sich von letzterer bestrahlen sondern ersterer verschmilzt mit der Geschichte, deren Ablauf er nicht allein mit den Augen sondern mit seiner kompletten Schnittstelle verfolgt, sozusagen breitbandverlinkt mit dem Medium, also mit letzterer." Der Anspruch ist gut, aber auch hier reicht die Vision weit über die Realisation hinaus, zudem die verlaufenden, ineinanderlaufenden Schriften zugleich Kommunikationshindernisse bereiten. 2. Eine andere Form der literarischen Netzkunst lässt sich in den eher puristischen Arbeiten der Londoner Künstlergruppe I/O/D unter http://www.jodi.org bzw http://www.backspace.org/iod/ finden. Einem sehr radikalen Verständnis von "literarischer" Netzkunst begegnet man unter der in der Literaturszene immer wieder genannten Plagiatoren-Netzkunst http://0100101110101101.org. Hier werden endlose Zeichenreihen in für Menschen nicht mehr sinnvoll zu verarbeitendem Tempo produziert, die entfernt an die beiden Supercomputer in der SF-Apokalypse "Colossus" erinnern, die zwar miteinander kommunizieren, aber Menschen längst aus ihrem Diskurs ausgesperrt haben. B. Die literarische Netzgesellschaft
Nicht nur technologisch, sondern auch sozial führt das Netz zur Konnektion von Schriftstellern, die man mit dem alten Schlachtruf eines Schriftstellerkongresses der Siebzigerjahre "Einigkeit der Einzelgänger" belegen könnte. Prägnante Beispiele sind der internet literatur webring bla, der eine Reihe sehr unterschiedlicher Literaturinitiativen zusammenfasst. Die Mailing-Liste Netzliteratur, die sich im guten wiDebattierklubaotischen Sinne zu einem literarischen Debattierclub entwickelt hat, ist die herausragendste Informationsquelle für Netzliteraten. Wer Informationen aus erster Hand über Literatur im Netz, Wettbewerbe, Veröffentlichungschancen etc. sucht, schließt hier in ganz anderer Weise zur Welt der Literatur auf, als das in klassischen Literaturzirkeln je möglich wäre. Die Netzliteratur-Mailingliste ist ein mehr oder weniger intimer, aber eben öffentlicher Stammtisch, der auch immer wieder Projekte einleitet und Einblick in die Arbeitsweisen von Online-Literaten gibt. Wer Internet-Literaturpreise gewinnen will, ist nicht falsch beraten, sich auf dieser Liste zu tummeln. Viele preisgekrönte Urheber der hier besprochenen Projekte lassen sich auf dieser Liste finden. Präzeptor dieser Liste ist inzwischen Oliver Gassner, dem man – meinen Erfahrungen nach zu schließen, auch nachts um drei Uhr noch ein email schicken kann und mit postwendender Antwort rechnen darf. Der Anschluss an solche Netzinitiativen erfolgt problemlos durch eine Email-Anmeldung und gibt den Mitgliedern auch Einblick in die Archive, in denen die Diskurse der vergangenen literarischen Jahre gesammelt werden. Auch das ist einzigartig, weil die "Gedankenküchen" eben nicht entsorgt werden. Ein spezifischer Service sind auch Newsletter – wer sich weiter über Literatur aufklären möchte, insbesondere über die wuchernden Theorien zum Thema Hypertext. kann etwa den von http://www.dichtung-digital.de/ wählen. Hier finden sich die engagiertesten Beiträge, die zum nicht geringsten Teil von Mitgliedern der Mailing-Liste Netzliteratur stammen. Ferner: inkspot - Writer`s Resources on the Internet - IG-Medien (München) - schule für dichtung (sfd) - Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften e.V. - Deutsches Literaturinstitut Leipzig. II. Selbstvermittlung der Autoren und VermittlerKlassische Autoren mögen beklagen, dass jeder Publikation eine Reihe von Schritten vorgeschaltet ist, bevor sie ihr Publikum erreichen kann. Letztlich sind unternehmerische Entscheidungen der Verlage, Produktionszeiten der Verlage und Drucker, die Distribution verzögernde Momente der Textpublizität. In Zeiten flüchtender Aufmerksamkeit, in der die Morgennachricht am abend schon überholt ist, wird die instantane Reaktion zum Online-Gebot der Stunde, wenn nicht der Minute. Durch die Selbstveröffentlichung verändert sich diese lange Kette einer Publikation. So verkürzen die literarischen Initiativen des Netzes die Anlaufzeiten auf radikale Weise. Ich selbst habe auf eigene Textangebote bereits erlebt, dass sie eine Stunde später – formatiert im Netz – standen. Es gibt inzwischen im Übrigen Autorenpublikationssysteme, die einzelnen Autoren ein Veröffentlichungsrecht per password einräumen, um erstens die Personalressourcen der Redaktion, so sie denn überhaupt vorhanden sind, zu schonen und zweitens aktuelle Reaktionen zu ermöglichen. Der Autor bewegt sich technisch in einem vorfabrizierten Kontext, nutzt etwa ein template, das Form und Design festlegt, um lediglich noch seinen Text oder seine Bilder in den jeweiligen Textkorpus zu integrieren, und somit Texte fast instantan online zu stellen. Beispiel wäre das umtriebige ZYN! Satiremagazin, das einzelnen Autoren Kolumnen einräumt, die eigenverantwortlich betreut werden und nicht länger vom mastermind des Chefredakteurs oder Herausgebers beherrscht werden. Entsprechend produktiv bis chaotisch präsentieren sich solche Magazine, die aber etwa im Fall von zyn mit ca. 30.000 pageviews im Monat eine enorme Breitenwirkung haben. Die neue Autorensouveränität reicht aber noch erheblich weiter. Autoren mit eigenen Homepages bzw. websites werden im Netz zu Selbstvermittlern, Designern und Distributoren ihrer Arbeit. Nicht länger ist der Autor auf Herausgeber, Drucker, Promotoren oder Literaturagenten oder etwa lästige dead lines verwiesen. Ab jetzt leistet er das alles in Personalunion und befreit seine Texte vom Schubladendasein. Vormalige Qualitätsfilter, heilsame Zensuren und Kritiken etc. finden indes nicht oder nurmehr in geringem Umfang statt, sodass in diesen Textmeeren die Selektivität des Lesers, das Ringen der Autoren um Aufmerksamkeit zum zentralen Problem wird. Vgl.: Heinrich Gartentor - ein Interventionist im Internet. Technische Randbemerkung – wenn gewünscht: Homepages können heute bereits kostenlos bei vielen Providern eingerichtet werden, in einigen Fällen mit unbegrenztem Speicher und ohne störende Bannerwerbung oder sog. Pop-ups (Guter Provider: http://www.crosswinds.net). Auch der Transfer von der eigenen Festplatte auf die Server ist einfach: Entweder per FTP-Software oder gleich online durch entsprechende Programmiereinrichtungen der Provider. Beispiel des Vortragenden: Virtuelle Textbaustelle. Statistiken, Gästebücher, Foren, Suchmaschinen können ebenfalls kostenlos eingerichtet werden und vermitteln dem Urheber einen Überblick über die Nutzung und Akzeptanz seiner Seite. Wer gut besuchte Seiten präsentiert, hat zudem die Möglichkeit, über Bannerwerbung eine Einkommensquelle zu schaffen. Die mit diesen einfachen Selbstpublikationsmöglichkeiten verbundene Unübersichtlichkeit zu beheben machen sich solche Literaturinitiativen anheischig, die Literaturtips mit Rankings, Kritiken, Rezensionen präsentieren, um Navigations- und Orientierungshilfen zu geben. Vgl. etwa die berühmteste Liste: Ollis kommentierte Links zur Literatur, weiterhin: Berliner Zimmer, Deutschsprachige Literaturmagazine im Internet - Die Seite für Autoren - Deutsche Literaturseiten im Internet – Megalinksammlung zu deutschen Online-Texten (Homepage Helmut Schulze). Das letzte Beispiel macht aber sofort klar, dass solche Riesensammlungen schließlich doch wieder Orientierungsprobleme aufwerfen. Zugleich finden sich auch viele Promotiongelegenheiten für unbekannte Autoren und ungezählte einfache Möglichkeiten, eigene literarische Werke zu veröffentlichen: Autorenecke, Literaturcafé, Textgalerie. Nun ist mitunter die Einfachheit des Zugangs ein Stigma und etwa die Autorenecke produziert ein Ambiente, in dem sich nicht jeder wohl fühlen mag, weil zwischen Literaturangebot, Textabladestelle und Archiv kaum mehr signifikante Unterschiede bestehen. In der Struktur des Internets liegt es begründet, dass auch der konventionelle Weg vom Autor zum Leser sich beschleunigt. Immer wieder wird berichtet, dass die Suche nach der Veröffentlichung im Internet reale Chancen hat: Michael Fischer etwa fand für seinen Kriminalroman Skorpion! einen Verlag, als die download-Quote zum Indiz der Akzeptanz, sprich der Vermarktbarkeit, wurde. III. Wettbewerbe Wer im Internet Literaturpreise gewinnen will, kann beim Uschtrin-Verlag gut sortierte Auslobungsübersichten finden. Der renommierteste Preis war seinerzeit der Wettbewerb "Pegasus", den die Wochenzeitung "Die Zeit" in Zusammenarbeit mit anderen Firmen jährlich veranstaltete. Beim Wettbewerb 1998 präsentierten sich mehr als 250 Beiträge. Sieger war der Beitrag: "Die Aaleskorte der Ölig". Vor wenige Tagen ist übrigens die Bewerbungsfrist für den arte-Wettbewerb zu Ende gegangen und vielleicht finden sich hier ja neue Perlen der digitalen Literatur. IV. Zur erträglichen Leichtigkeit der Beziehung zwischen Publikum und WerkBei etablierten Schriftstellern hält sich das Interesse am Netz in Grenzen. NULL - "ein Ort für gute Texte im Netz" war eine literarische Initiative des Dumont-Verlags unter der Federführung von Thomas Hettche, die konventionelle Texte von Autoren präsentierte, aber dem Medium keine eigene Dynamik abgewinnen wollte und vielleicht auch deshalb nicht fortgeführt wurde. Zwar haben die meisten Verlage inzwischen einen Internet-Auftritt (Vgl. etwa die Verlagsprogramme von Hanser, Rowohlt und dtv), aber es sind nur wenige, die tatsächlich das Medium selbst als literarisches Forum behandeln. Dieser Befund von Desinteresse, aber wohl auch auch Berührungsangst gilt auch für bekanntere Autoren. Mehr oder weniger arrivierte Autoren wie Burkhard Schröder, Roger Graf und Emil Zopfi werden in ihrer Internetpräsenz immerhin zu Autoren zum Anfassen. Insofern entsteht eine neue Intimität im Umgang mit den Literaten, die vormaligen Lesern zumeist verschlossen war. Die gegenwärtige bekannteste Nutzung des Internets als literarisches Forum demonstriert Stephen King, der ein Werk exklusiv in das Netz gestellt hat. Das Projekt ampool zeigt schließlich, dass jüngere, halbarrivierte Autoren zwar im Netz präsent sind, aber die Verleitung zu rhapsodischen, idiosynkratischen Texten, Gedankenschnipseln, literarischem Allerlei wird hier besonders deutlich. Man schreibt halt, was sonst vielleicht dem inneren Monolog der Literatenseele vorbehalten bliebe oder der Gnade des Vergessens übergeben würde. Wie findet der Leser aber die Texte, die ihn interessieren? Folgende Links für den aufgeweckten "Nachleser": Bibliotheken, Bücher, Berichte - Karlsruher Virtueller Katalog, KVK - SUBITO – der Dokumentenlieferdienst der deutschen Bibliotheken - Bibliotheken im Internet - Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek - Bibliotheken, Bücher, Berichte - BiN Bücher im Netz - Buchinfo - Olli—Oliver Gassner Links zur Literatur - BookWire – Die Site "Querlesen" http://www.querlesen.de/index2.html bietet dem Leser einen interessanten, sicher erweiterbaren Ansatz, seine Vorlieben mitzuteilen, um dann entsprechende Lektüren anzuempfehlen. Der Leser wählt hier Kategorien in einem binären Schema "Literarische Inhalte" und "Erzählweisen", etwa: "Außen- und Innenansichten des Lebens und der Menschen" mit "Narrative Verführung". Das verdinglicht zwar Literatur, presst sie ins Schema, aber wer wäre nicht dankbar, wenn er schon sein Interesse in diesen Kategorien wieder findet, um auf diese Weise seinen Querschnitt von Welt- oder Internetliteratur zu finden.
V. Die Zukunft der Netzliteratur 1. Ob die Netzliteratur eine Zukunft hat, mag eine müßige Frage sein, wenn schon ihre Gegenwart so fragil bis flüchtig ist. Welche Bedeutung hat Literatur in vernetzen Gesellschaften überhaupt noch? Fraglich sind mit der elektronischen Archivierung nicht nur wirtschaftliche Einbußen klassischer Verlage verbunden, sondern auch unabsehbare Strukturveränderungen zu erwarten, die nur in einer Gesamtschau der medialen Veränderungen einer Gesellschaft beantwortet werden könnten. Aber wer könnte das schon leisten? Das Internet ist sowohl Massenmedium als auch Einzelmedium und wechselt zwischen diesen Zuständen auf Grund seiner besonderen Technologie permanent. Deshalb ist nicht nur eine Literaturtheorie des Netzes, sondern auch übergreifend eine Medientheorie des Netzes immer in der Spannung zwischen diesen Zuständen zu ermitteln. Menschen werden in Zukunft durch eine Veränderung der Computer, der Netze, der elektronisch, also virtuell vorhandenen Angebote in immer leichterer Weise nicht nur auf kulturelle, sondern auf nahezu alle Ressourcen zugreifen können, die bisher eher privilegiert in real Life verfügbar waren. 2. Die Aussagen zu dem angeblichen Verhältnis von Print- und Digitalliteratur haben schon deshalb beschränkteste Haltbarkeit, weil sich die Frage nicht auf die vordergründige Differenz bescheidet, dass das klassische Buch eine sinnliche Qualität besitzt, die digitale Texte nie haben werden. Zwar mögen das Rocketbuch und vergleichbare Produkte noch abschrecken, weil die Konzentration auf den Monitor ein ernst zu nehmendes Hindernis für das Lesevergnügen darstellt. Aber mit der Veränderung digitaler Produkte hin zu taktilen Oberflächen, zu elektronischem Papier, schließlich zu einer Unsichtbarkeit des Interface werden auch diese Differenzen vermutlich in irgendeiner Zukunft obsolet sein. Entscheidend ist vor allem, dass inzwischen das elektronische Buch nicht mehr ein Residuum weniger Verlage ist, sondern auch die Großen das Geschäft mit der literarische Zukunft darin wittern. 3. Entscheidender ist aber, ob das Leseverhalten, das sich in der so genannten Gutenberg-Galaxis noch als Königsweg der Welterschließung angeboten hat, in den Zeiten einer völlig veränderten Konnektierung von Menschen und Sachverhalten erhalten bleibt. Der Hypertext, ob nun als literarisches oder allgemeines Phänomen von Netztexten, ist eben mehr als eine techno-stilistische Variante klassischer Textproduktionen, sondern verändert auch unmittelbar die Rezeption. Jedes Buch tendiert dazu, einen geschlossenen Kosmos seiner Weltsicht zu präsentieren. Lektüre, die sich dagegen aus einem patchwork aus Wissen und Müll nährt, findet nicht leicht zu klassischem Leseverhalten zurück. 4. So stößt die Vernetzungseuphorie an menschliche Rezeptionsgewohnheiten und –grenzen. Enzyklopädien, die in endlosen Konnotationssystemen den Leser mit dem Eindruck des Fragmentarischen belasten, sind zweifelhafte Unternehmungen. Niemand würde es auf Dauer aushalten, ständig in fremden Bewusstseinen herumzuspazieren. Dem Cyberflaneur wird viel abverlangt, wenn er etwa in die Enzyklopädie http://www.nic- las.ch/enzyklopaedie/show.asp?area=develop&diff=wissen&displaymodus=long einsteigt. Der alte Anspruch einer Enzyklopädie ist die Versammlung eines kollektiven Wissens, eines Wissens, das sich eben nicht in dieser oder jener persönlichen Welterschließung bescheidet, sondern der Welt eine objektive Gestalt und Deutung verleiht. Enzyklopädien wie die vorliegende basieren nicht auf koordinierten Autorenteams, sondern auf rhizomatischen, wildwuchernden Strukturen, die keine Schere mehr akzeptieren. Hier werden im Sinne von Deleuze/Guattari zwar tausend und mehr Plateaus gebaut, aber wer will sie noch betreten und wie soll all das ins reale oder virtuelle Leben wachsen. Ähnlich präsentiert sich die "Imaginäre Bibliothek" von Heiko Idensen und Matthias Kron. Zu ihrem Selbstverständnis sagen die Autoren: "Die Konzepte für eine solche hypermedial-verknüpfte, diskontinuierliche Ideenproduktion und Weitergabe kompilieren wir aus der Literatur, der Ars Combinatoria, den historischen CUT-UPS eines Materialismus, der aus einer Montage von Einzelmomenten übergreifende Konstruktionen entwickelt und den subkulturellen Ursprüngen der "Computerkultur" in den 60er-Jahren der USA (z.B. "Computer LIB -Dream machines" von Ted Nelson oder Learys Behauptung, die Computer seie60er-Jahre Drogenkultur der 60er Jahre nicht denkbar!), die, verbunden mit Hyper-Text Programmen, zu Möglichkeiten vielfältig vernetzter Schreib- und Leseoperationen führen." Schön! Aber zwischen einer Ars Combinatoria und Cut-up-Literaturen liegen literarische Welten, zwischen denen sich die Autoren entscheiden müssen, wenn ihre Texte im Sinne von Roland Barthes schlüssig bleiben sollen. Schlüssig nicht im Sinne einer Korrespondenz zur Welt, sondern in ihrer eigenen Struktur. Zum ehesten handelt es sich bei diesen Kombinationen um Selbstverständigungstexte, die vielleicht den Autoren helfen, sich selbst zu lesen, weniger aber Lesern, die ein fremdes Konzentrat von Welt suchen. 5. Auch die Sprache selbst ist durch das Medium längst in ihren Grundfesten so berührt, dass die Einflüsse auf die Literatur immer massiver werden. Tech-Talk, englische Beimischungen, Verkürzelungen, Piktogramme fransen die Sprache als ein kollektiv verbindliches Symbolsystem aus. Wer hat schon rezeptive Lust, fremde Programmierungen als Literatur zu lesen, wenn er selbst die Struktur dieser Sprache nicht kennt. Nicht wenige Sprachgebilde des Internets sind eigenartige Kombinationen, die den Vorwurf eines schleichenden bzw. sektoralen Analphabetismus begründen könnten. Allein der Kommunikationsstil der emails hat sich meilenweit von der vormals selbstverständlichen Briefkultur verabschiedet und trennt in den vielen verschiedenen Jargons die User in immer unübersichtlichere Szenen. Und selbst so relativ prominente Initiativen wie Gvoon lassen die Existenz eines Lektorats schmerzlich vermissen. 6. Wollte man aus der Vergangenheit literarischer Funktionen auf ihre Zukunft schließen, ist zu erwarten, dass die besonderen Erfahrungsgehalte der virtuellen Aufenthalte und Begegnungen im cyberspace zu literarischen Themen werden. Längst kristallisieren sich in den Netzwelten eigene Selbstentwürfe und Identitätserfahrungen jenseits der Ausgangswirklichkeit. Danach wäre die Literatur im Netz nicht länger die Fortsetzung der Wirklichkeit mit digitalen Mitteln, sondern eine autonome Wirklichkeit, nicht völlig verschieden von RL, aber doch als Erfahrungswelt anderen Regeln und "Verkehrsformen" gehorchend. 7. Die höchste Tugend des Lesers ist in Zukunft, die Auswahl zu treffen. Autoren können daraus nur den Schluss ziehen, ihr Textangebote so zu konzentrieren, dass die flüchtende Aufmerksamkeit des Lesers gefesselt wird. Das mag man kulturapokalyptisch beklagen, gar den Ausverkauf abendländischer Kultur darin erkennen, oder als heilsamen Prozess der Besinnung auf das Wesentliche beschreiben. Fest scheint aber zu stehen, dass dynamische Medien auch dynamische Rezeptionen auslösen und wer das Kommunikationsverhalten von Netzbürgern beobachtet, wird die schnelle, rhapsodische, instantane Reaktion häufiger kennen lernen als die alten Kontemplationszeiten, die vordem der Hochkultur gewidmet wurden. Maurice Blanchot meinte 1962 auf die Frage hin "Wohin geht die Literatur" , dass die Literatur auf sich selber zugehe, auf ihr eigentliches Wesen, das in ihrem Verschwinden besteht (M. Blanchot, Der Gesang der Sirenen, Berlin 1982, französische Ausgabe 1962, S. 265 ff.). Lange vor dem Internet gesprochen mag hier der Tatbestand geahnt worden sein, dass die Literatur sich im Großtext des Internets auflöst, weil sie als vormaliger Königsweg der Welterschließung untauglich geworden ist. Engagierte Positionen der Literatur, wie sie etwa in den Siebzigerjahren zwischen Böll und Bitterfeld auftauchten, sind im Netz allenfalls Mangelware. Echte Kontroversen, die etwa eine Gesellschaft über literarische Fragen hinaus polarisieren, gibt es nicht. Allenfalls Marginalien, wie etwa die Frage, wie viel Erotik verträgt ein Text, mögen wie im Fall des darob zerstrittenen literarischen Quartetts vorübergehend den Sturm im Wasserglas auslösen. Das literarische Internet kann auch darüber hinwegsehen, für digitale Produktionen gilt noch mehr als für Papier, dass sie geduldig sind. Goedart Palm Sonstige Ressourcen: WWW-Angebote des Verlagswesens - Amazon.de VlB - Verzeichnis lieferbarer Bücher - KNO-K&V Barsortimentskatalog - Stuttgarter Stadtbibliothek: Projekte - Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher - ZVAB - Bibliofind - Antiquarische Bücher suchen - Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Goethe-Institut - Frankfurter Buchmesse - Klassikerwortschatz Kinder- und Jugendliteratur im WWW - Sonntagsgeschichten: Neue deutsche Prosa - Hyperfiction - GVOON - WordPlay - The Kassandra Project - The Libyrinth - Erinnerung und Nachruhm - Hyperizons - Context 21 gegen@nfang - http://members.aol.com/hundspost/ - HUNDSPOST - Lettre international - Internet-Literaturcafé - Literatur und Medien - Nordnordwest - Parapluie - Der Salbader - The Thing - TightRope - Der Wandler - Das Media Laboratory des MIT - John Labovitz`s E-Zine-List - Deutsch-Referate - Schulothek - Buchjournal online - Der arme Poet - http://www.wahngedanke.de/ |
Zu Urheberrecht und anderen Rechtsfragen: