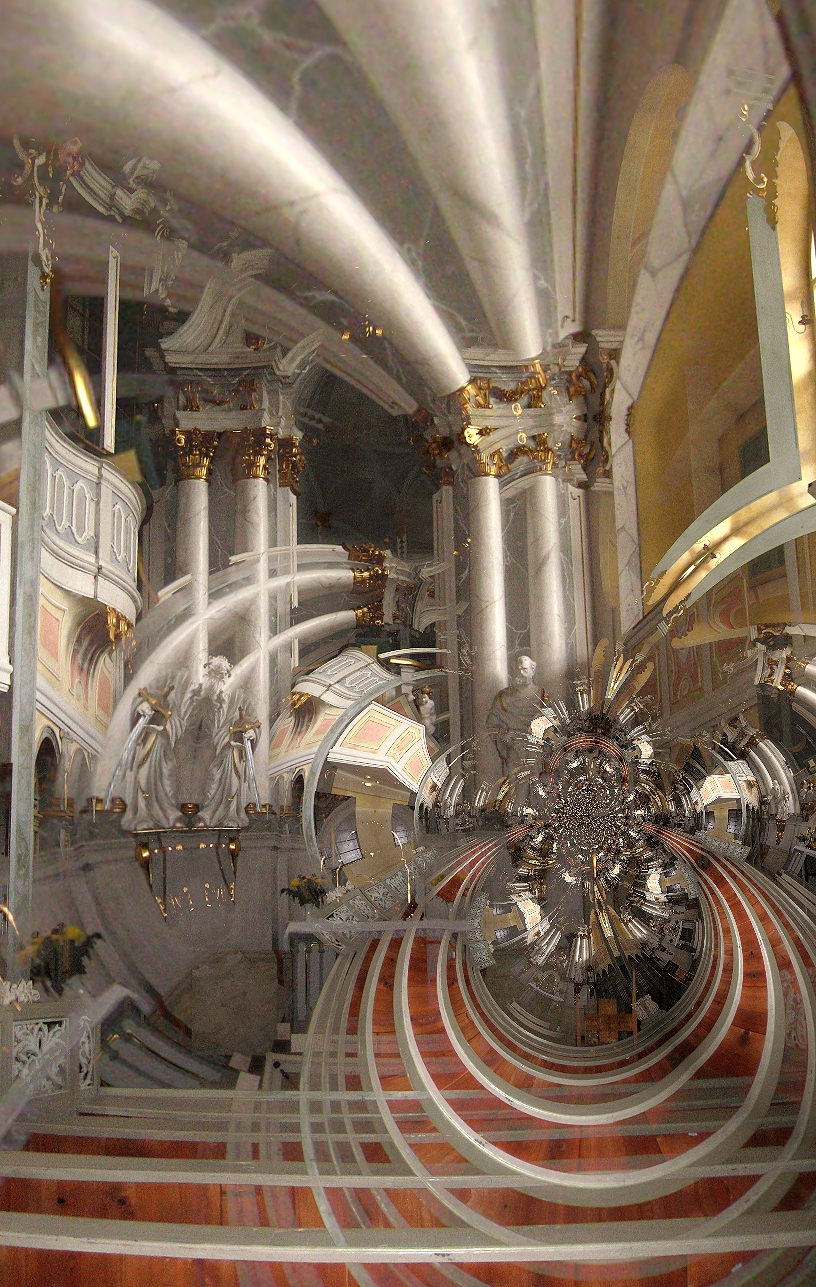|
|
Zur Konstruktion der Virtualität
|
(Ein
älterer, nicht fertig gestellter Text) Was aber
Virtualität sei, darüber vermögen nur Konstruktionen Aufschluss zu
geben...
I.
Aporien der virtuellen Evolution
“Woraus
aber die Dinge ihre Entstehung haben, darein finde auch ihr Untergang
statt, gemäß der Schuldigkeit. Denn sie leisteten einander Sühne und Buße
für ihre Ungerechtigkeit, gemäß der Verordnung der Zeit.” Entstehung
und Untergang der Dinge stehen Anaximander zufolge unter dem Gesetz der
Zeit. Das irritiert unser Verhältnis zu den Dingen zum wenigsten, wenn
auch die Diversifikation des Zeitbegriffs verschiedenste
“Verordnungen” kennt. Dagegen
provoziert uns die Durchdringung des Evolutionsprinzips mit dem
Schuldprinzip. Diese Ineinssetzung stört ein Fortschrittsparadigma, das
den Zusammenhang zwischen den Dingen als Entwicklung vom Einfachen zum
Komplexen faßt, ohne diese Differenz anders denn als funktionalen
Zugewinn zu fassen. Die zeitgenössischen Fassung des
Fortschrittsparadigmas bleibt selbst die Antwort schuldig, warum etwas
entsteht und vergeht. So bemühen sich evolutionäre Prinzipien wie
Selektion, Variation und Stabilisierung zwar die Verlaufsgeschichte zu
qualifizieren, aber warum überhaupt eine Welt des Werdens projektiert
scheint, bleibt offen. Ontogenetische, phylogenetische, soziologische oder
technologische Entwicklungen werden als Funktionsdifferenzierung
verstanden. So ist es etwa naheliegend, moderne Gesellschaften als
funktional ausdifferenzierte Systeme und Untersysteme zu beschreiben, die
Aufgabenzuweisungen entzerren, und nur spezifische Medien der
Kommunikation akzeptieren, um Komplexität zu reduzieren und so zugleich
mehr Komplexität verarbeiten zu können. Diese systemische
Entwicklungstheorie, die nicht nur ihren Gegenstandsbereich, sondern auch
sich selbst unter die Maxime Spencer Browns “Draw a distinction”
stellt, formuliert den Weltgeist als fortschreitenden
Differenzierungsprozess. Aber die Unterscheidung zwischen Differenz und
Nichtdifferenz ist in diesem Programm nicht vorgesehen.
Nichtunterschiedenes erschließt sich keinem Begriff, weil der Begriff
bereits die Unterscheidung in sich trägt. Mit jeder Entwicklung wird der
Bereich der Differenz vergrößert, ohne sagen zu können, was
nichtunterschieden bleibt. In der Herrschaft der Differenz wird
autologisch zugleich die Herrschaft des Nichtunterschiedenen begründet,
weil anders jede Differenz gegenstandslos bliebe. Wäre aber alles
unterschieden, wäre das Gesamt der Erscheinungen immer noch
ununterscheidbar, weil alle Differenzen in der Gemeinsamkeit des
Unterscheidens zusammenlaufen müssen. Diese
Entwicklungslogiken besitzen zwar prozedurale Erklärungen, sind aber
sprachlos gegenüber Anaximanders kühner Entwicklungssemantik, Dinge
entstünden und vergingen gemäß ihrer Verschuldung. Anaximanders
Verschuldensprinzip läßt sich zwar nicht semantisch retten, weil die
Ordnung der Dinge unserem Verständnis nach nicht moralisch konstruiert
werden kann - aber der
Versuch, Entwicklungen unter ein Austauschprinzip zu stellen, sie
semantisch zu definieren, provoziert jede rein prozessuale
Entwicklungsidee, die in eine nicht vollzogene Zukunft weist. Mit anderen
Worten: Warum bleibt nicht alles so, wie es ist? Warum verändern sich
Zustände? Selbst Kosmogonien, Heilsgeschichten, die den Geschichtsverlauf
melioristisch beschreiben, erklären nicht, warum der Wille des Schöpfers
auf eine Entwicklung zielt und nicht den Zustand der Vollkommenheit
verwirklicht. Das Schöpfungsdenken formuliert eine Teleologie der letzten
Dinge aus einem Ursprung, der selbst ohne Ursprung ist. Das ist jenseits
eines endlichen Fassungsvermögens, sodass alles Ursprungsdenken nie mehr
als einen infiniten Rückgriff eröffnet. Dieser infinite Rückgriff wird
aber so selbst zum Zeichen der Unendlichkeit. Nicht dem ursprungslosen
Ursprung, allein dem Verlauf kann sich Philosophie widmen, weil der
Verlauf das Erlebnis ist, über das Menschen reden können, weil sie
selbst das Erlebnis sind. Dieses philosophische Programm ist ohne Anknüpfungen
an einen Ursprung oder an ein Ende, hier finden weder Schöpfungen statt
noch erfüllt sich der Weltgeist in seiner selbstbewussten Entfaltung.
Menschen denken in Zwischenzeiten wie -räumen, ohne Bodenhaftung. Fortschrittsideologie
wird so zur Entgegenwärtigung des Bestehenden, das ohnehin nur
konventioneller Wahrnehmung als persistierender Zustand erscheint. Aber
das etwas “ist” und nur in diesem Sein, in dieser Einmaligkeit und
“vorübergehenden Persistenz” Eigenwert besitzt, ist dem abendländischen
Entwicklungsdenken zur Restgröße verkommen.
Auf dieser Schnittstelle zwischen dem Allgemeinen, das die
Entwicklungsidee repräsentiert, und dem Besonderen, das auf der Stasis
eines Phänomens, einer Situation, eines Moments beharrt, ist zu
insistieren, wenn das Denken sich nicht völlig an eine offene Zukunft
vergeben will. Handeln setzt immer eine Dialektik zwischen einem Zustand
und seiner Veränderung voraus. Der Zustand ist hypothetischer Natur für
das Handelnkönnen, aber zugleich hat der Zustand in seiner phänomenologischen
Beschaffenheit einen praktischen Eigenwert. Dass etwas “ist”, ohne auf
sein Werden zu spekulieren, legitimiert phänomenologische Zugriffe, die
das Wesen eines Dings erfassen wollen. Dabei bewegt sich jede Phänomenologie
in dem Selbstwiderspruch, dass das Ding im Moment seiner Erfassung bereits
ein anderes ist, weil es physikalisch keine Gegenstände in Ruhe gibt. Phänomenologie
ist damit ein praktischer Welterschließungsmodus, ohne absolute Wahrheit
reklamieren zu können. Fortschrittsideologie und Menetekel-Philosophie teilen sich in die Verwaltung der Zukunft. Das Menetekel, das schon je geschichtsmorphologischen Entwürfen angelegen war, extrapoliert negativ auf die Zukunft. Spengler, Anders etc. nehmen aus sehr unterschiedlichen Gründen zivilisatorische, kulturelle, technologische Entwicklungen zum Anlass, den Untergang des Abendlands, den Tod des Subjekts oder gar die Vernichtung der Erde vorherzusagen. Solche Prophezeiungen sind bereits deshalb nicht ernst zu nehmen, weil die Entwicklung komplexer Zustände keinem bislang bekannten Entwicklungsgesetz unterliegt. So sind etwa technologische Entwicklungen regelmäßig mit Menetekeln verbunden, die sich in der Rückschau als kurzschlüssig darstellen. Der Kurzschluss liegt regelmäßig darin, zukünftige Faktoren nicht extrapolieren zu können, weil dafür der Weltprozess in toto in ein Laplace-Universum radikaler Kausalitäten gestellt werden müsste. Zwar kann man das vermuten, aber es gibt keine endliche Berechnungsmöglichkeit für den Zustand des Universums. Durch
den Zuwachs an Komplexität und der Zunahme von technologischen
Halbwertszeiten wird Prognostik vollends zur Geschichtsspekulation.
Folgenlos sind indes diese Spekulationen deshalb nicht, weil sie selbst in
den Geschichtsverlauf eingreifen, den sie beschreiben. Zwar läßt sich
auch über diese Eingriffe nicht sagen, ob sie im Sinne einer praktischen
Vernunft melioristisch oder amelioristisch auf die beschriebenen Prozesse
einwirken. Aber sie lösen Handlungen aus und beeinflussen den
Geschichtsverlauf. II. Zur Konstruktion der VirtualitätAm
Anfang war die Virtualität. Jeder Anfang ist aber selbst virtuell, weil
er auf seinen eigenen Ursprung zurückweist. Jeder unendliche Regreß auf
eine Kosmogonie kann nur durch eine Virtualisierung durchbrochen werden,
die die Konstruktion einer raumzeitlichen Ausgangswelt transzendiert, um
einen Anfang dadurch herzustellen, daß sie ihn unterstellt. Die
christliche Theologie hat im Schöpfungsmythos diese Schnittstelle
zwischen Gott und seiner Welt verortet. Nicht anders hat Aristoteles in
der dialektischen Figur des unbewegten Bewegers zwei gegenläufige
Prinzipien miteinander verschmolzen, ohne diese Konstruktion vermittelbar
zu machen. Der Rückgriff auf den Ursprung des Schöpfers wurde damit
abgeschnitten, weil entweder die Frage inhibiert ist oder der Schöpfer
als ewig gesetzt wird. Ewigkeit ist dabei nichts anderes als ein logisches
Verfahren für dem Raum-Zeit-Kontinuum unterworfene Wesen, eine jenseits
ihrer Vorstellung angesiedelte Kategorie zu finden. Das Ewige ist zeitlos
und damit Raum-Zeit-Wesen nicht vorstellbar. Da aber auch der Ursprung der
Zeit und des Raums nicht vorstellbar ist, ist es als logische Komponente
einer ursprungslosen Konstruktion unverzichtbar. Mit anderen Worten: der
Ursprung ist dunkel und zur Zeit – in der Zeit – nicht
rekonstruierbar. Schöpfungsmythen
beziehen ihren Stoff aus der Beschreibung von Konstruktionen, die einem
Programm folgen. Dabei wird die Differenz, ob etwas ist oder nicht, nicht
entschieden, weil der Anfang der Schöpfung gesetzt ist und nicht in Frage
gestellt wird. Sollte entschieden werden, ob etwas geschöpft wird,
impliziert das bereits die Schöpfung. Deshalb kann man sich nicht Nichts
vorstellen, sondern “Nichts” nur als Grenzwert virtueller Schöpfungen
unterstellen, ohne ihm Existenz zuzuweisen. Virtualität
ist nichts anderes als die Frage nach der Schöpfung. Nun ist für Schöpfer,
die selbst Teil einer Schöpfung sind, nicht das Paradox einer “creatio
ex nihilo” prägend. Dabei ist die Frage nach der Schöpfung des Schöpfers
solange suspendiert, so lange immanente Szenarien, mithin Kosmogonien Rückschlüsse
auf sich selbst ziehen wollen. Jede
Neuschöpfung hat Ursprünge, Ausgangspunkte, Wesensmerkmale, die Schöpfungsprogramme
anleiten. Auch unter immanenten Bedingungen entwickeln sich neue Formen
mit unbekannten Qualitäten in der Zeit aus niederen Formen. Die
Verbindung der Virtualität mit der Simulation resultiert aus dieser Nähe
der Ausgangswelt zu Nachfolgewelten. Aber es geht nicht darum, den Grad
der Annäherung dieser Welten zu ermitteln, allein weil der Mensch seine
kreative Nachschöpfung in der Simulation auf Großartigste bestätigt zu
sehen glaubt. Kant hatte schon in den “Antizipationen der Wahrnehmung”
dekretiert, dass in allen Erscheinungen das Reale eine intensive Größe,
d.i. einen Grad habe (KdrV, S. 208). Wahrnehmung ist nicht möglich, wenn
der Erscheinung jede Realität mangelt. Aus der Erfahrung könne niemals
auf einen leeren Raum oder eine leere Zeit geschlossen werden (KdrV, S.
212 f.). Allein gebe es für die Wahrnehmung eine Abfolge von Realitätsgraden,
die bis zum Nichts abnehmen kann. Letzteres ist aber nicht mehr
wahrnehmbar. Wenn auch der Erfahrung leerer Raum und leere Zeit
verschlossen sind, beginnt die Konstruktion in nichtdimensionierten Entwürfen.
Das Postulat der Möglichkeit der Dinge fordert nach Kant, dass der
Begriff derselben mit den formalen Bedingungen einer Erfahrung
zusammenstimme (KdrV, S. 249). Begriffe ohne Erfahrung sind
gegenstandslos, weil sein Objekt nur in der Erfahrung angetroffen werden
kann. Radikal
ist die Frage zu stellen, was Schöpfung ist, um so mögliche Welten
aufzuschließen. Nicht technologische Hindernisse wären zu vergegenwärtigen,
sondern die Bedingungen einer Konstruktion, die zunächst nichts anderes
als einen transrealen Status reklamiert. Entscheidend wäre nicht die
Kompossibilität dieser Welt mit der Ausgangswelt, sondern
Konstruktionsmomenten zu verbinden, um Funktion herzustellen. Insofern
sind die zeitgenössischen Simulationen, die mehr oder weniger erfolgreich
ihrem eigenen Ursprung nachgehen, nichts anderes als eine Rückkehr zum
Bestehenden. Virtualität zielt dagegen auf Nichtbestehendes. Das
Nichtbestehende ist keine Variante einer Schöpfungsweise, sondern der
Vorwurf einer anderen Welt. 2. KonstruktionMit
anderen Worten: Was ist konstruierbar? Konstruktionen sind Kompatibilitätsentscheidungen.
Es lässt sich etwa kein Gebäude ohne ein Fundament erbauen, wenn die
Konstruktion in einem Newton-Universum entstehen soll. In einer
Zeitpfeilwelt sind keine Revisionen möglich, die in einer Zeitschlaufe zu
dem Beginn der Konstruktion zurückkehren könnten, um das zu beheben, was
in der Anfangslogik gesetzt wurde. Zwar gibt es Konstruktionsreihen, die
beliebig neu gestartet werden können, aber sie sind gleichermaßen an die
Grundkonstituentien einer raumzeitlichen Konstruierbarkeit gebunden. Virtualität
prätendiert dagegen, zeitreversible Entscheidungen zu treffen, weil
Konstruktionsentscheidungen jeder Zeit an einen beliebigen Zeitpunkt zurückgeführt
werden können. Virtualität ist somit die Ineinssetzung von Planung und
Konstruktion in einem Regelsystem, das lediglich voraussetzt, in sich
geschlossen zu sein.
Zwischen
Design und Konstruktion bestehen in einem virtuellen Sphäre keine starren
Grenzen mehr, es beginnt eine Osmose zwischen der Konstruktion und ihrem
Entwurf. Diese Wechselseitigkeit schließt zu einem Autodesign auf, das
nicht nur einer programmatischen Autopoiesis folgt, die ihre systemische
Gestalt in Differenz zu ihrer Umwelt aufrecht erhält. In der Konstruktion
verändert sich vielmehr das Programm, das wiederum die Konstruktion
anleitet. In diesem konstruktiven “feedback” ist das Programm selbst
Änderungen unterworfen, es gibt keinen evolutionären Plan, der etwa
einem persistierenden Willen unterstellt werden kann, sondern selbst
evolutionär ist. In der Virtualität wird die Evolution selbst
autologisch, d.h. sie entwickelt sich selbst als Evolution. Danach wären
keine entwicklungstypischen Parameter mehr wahrscheinlich. Diese Art von
virtueller Evolution lässt sich auch nicht mehr durch eine evolutionäre
Semantik beschreiben, die einem Leitmotiv folgt. “The survival of the
fittest” hat zwar Plausibilitätscharakter, aber in diesem
Evolutionsmotiv wären die Komponenten zu unterscheiden, die erst zur
Selbstbestimmung der Evolution führen, welche Eigenschaften fortgeführt,
entwickelt oder aufgehoben werden. Die Schöpfung liegt ab jetzt auf dem
Reißbrett und muss für sich selbst entscheiden, wie sie sich entwickeln
will. Meliorisierungen
- schneller, größer, weiter – verbinden sich mit Konzepten, die
auf andere Arten der Weltschöpfung und ihrer Erschließung dringen.
Koevolution von Sphären und Protagonisten als Planungsspiele und
Echtzeitszenarien. Was ist eine Welt? Der Begriff birgt das Paradox, das
schon im Ursprungsmythos verankert ist. Welt als Ganzes ohne Grenze oder
Welt in der Welt? Definitionsvorschlag wäre: Ein Ensemble relativer
Geschlossenheit mit wiederkehrenden Regeln ohne teleologische Begrenzung.
Teleologie ist immer der Versuch gewesen, Entwicklungen Zwecke überzustülpen,
die entweder völlig allgemein waren oder im Laufe der Entwicklung
revidiert werden mussten. Danach wäre keine teleologischen Konturen zu
ziehen, sondern Komponenten zu setzen, die sich in der Zeit reproduzieren
und emergente Erscheinungen zulassen. Dieses Prinzip der “Emergenz”
ist das zentrale Phänomen von Weltschöpfung – nicht als Entelechie,
sondern als Komplexitätsmehrwert, der neue Entwicklungsreihen
stabilisiert. 3.
Virtuelle Protagonisten Hans
Moravec hat postbiologische Szenarien beschrieben, die in der
Extrapolation von (Bewusst)Seinsformen enden, deren Existenzweisen,
Motive, Interessen etc. für Menschen nicht nachvollziehbar sind. Diese
Prospekte auf hypertechnologische Entwicklungen wollen keine Perspektiven
für Menschen sein, sondern beschreiben Zustände, in und neben denen
Menschen zwar möglich sind, aber keine Relevanz mehr für den Weltlauf
besitzen. Menschen hätten in dieser Welt etwa die Relevanz von Amöben.
Wenn
Anthropoiden über die Entwicklung des Menschengeschlechts Aussagen zu
treffen gehabt hätten, wären sie nicht ratlos gewesen. Sie hätten nicht
einmal die Frage verstanden, weil bereits die Frage den Vorgriff auf eine
andere Bewusstseinsform und mithin ihre Antwort impliziert. Die
“Entstehung des Neuen” (Thomas S. Kuhn) kann nur erkannt werden, wenn
das Neue sich im Rahmen tradierter Erkenntnis- und Anschauungsformen
bewegt. Erhalten bleibt in dieser Erkenntnisform die Dialektik von
Bedingungen des Erkennens und dem neu Erkannten. Danach ist dieses Neue
immer rückgebunden an das Bestehende. Wenn nun aber das Neue nicht
lediglich ein Paradigmenwechsel ist, sondern das epistemologische Terrain
von Menschen verlässt, wird es nicht länger erkannt. Die Evolution
dieses Neuen verschließt sich sowohl einer synthetischen Vernunft wie
auch der Überbietung von Beobachtern hin zu Beobachtungen höherer
Ordnungen. Das (Selbst)Bewusstsein widerstrebt dieser kontraintuitiven
Anmutung, weil das Bewusstsein seine Erkenntnisallzuständigkeit gegenüber
der Welt reklamiert. Mit anderen Worten: Ein Bewusstsein kann keinen höheren
Welterschließungsmodus denken als das Bewusstsein selbst. Nun ist diese
Intuition aber schon aus dem Grund paradox, weil das Bewusstsein in seiner
Welterschließung immer wieder auf das sokratische Wissen des Nichtwissens
zurückfällt: “Ich weiß, dass ich nichts weiß”. Zwar stellt sich
auch hier die Frage, wie das gewusst werden kann, wenn nichts gewusst
werden kann, aber dieses zirkuläre Unbehagen bestreitet zumindest
intuitiv nachvollziehbar die Erkenntnis des Weltganzen. Da die Evolution,
ob biologischer oder technologischer Art, aber nicht zu ihrem Ende
gekommen ist, besitzt das Bewusstsein zumindest die Potenz, die Frage nach
dem Fortgang zu stellen. Kontraintuitiv muß die Antwort lauten, daß
nicht das Bewusstsein der letzte Welterschließungsmodus ist. Auch wenn
Extrapolationen an dieser Stelle hochspekulativ bleiben, kann bereits das
Bewusstsein formulieren, dass das Bewusstsein transzendiert wird. Diese
Erkenntnis gehörte bisher in das Reservat der Theologie, weil die
Theologie die terra incognita Gott zuteilte. Gott ist danach keine Bewusstseinserweiterung,
sondern eine transbewusste Funktion ohne zurechenbare Eigenschaften. Ungefähr
hier enden alle Diskurse menschlicher Welterschließung. Auch
spinozistische Varianten, Gott in die Immanenz einer Substanz zu überführen,
eröffnen keine epistemologischen Zugewinne. Aufzunehmen ist aber die
Idee, dass das Bewusstsein in seinen Anschauungsformen nur ein vorübergehende
Welterschließungsweise darstellt. Nicht das Erkennen wäre der letzte
Zugriff auf die Welt. In
der Mystik und in verschiedenen Zweigen fernöstlichen Denkens,
vornehmlich dem Buddhismus, wurde versucht, die basale Beziehung zwischen
Subjekt und Objekt zu durchbrechen. Zumindest liegen hier Modelle vor, dass
sich Existenz von Erkenntnis abkoppelt, weil sie ihr Objekt verliert. Nun
leiden diese Modelle aber daran, dass dieses In-der-Welt-Sein Rückschritte
zu einem bewusstseinslosen Bewusstsein sind. Im Zustand der Immanenz von
Subjekt und Objekt wird das Bewusstsein ver-weltlicht, ohne noch ein
Selbstbewusstsein zu besitzen. Auch wenn diese Zustände reklamieren, das
Subjekt zu erleuchten, kann über das Substrat dieses Vorgangs nichts
gesagt werden. Markiert werden kann demgegenüber nur, dass es solange
keine Erkenntnis gab, solange kein Bewusstsein existierte. Dieser
Weltzustand ist keine privilegierte Position, sondern gilt für alle
nichtbewussten Entitäten. Es
bleibt dabei, dass das Bewusstsein erst nach seiner Emergenz Relevanz
beanspruchen kann, dass aber keine außerbewussten Aussagen über das Bewusstsein
getroffen werden können. Die Welt braucht aber kein Bewusstsein, keine
Erkenntnis, nicht einmal biologische Existenzen, um Welt zu sein. Danach
kann auch das Bewusstsein nicht der letzte Zugriff auf die Welt sein. Es
stellt sich bereits die Frage, ob Erkenntnis je ein zureichendes Weltverhältnis
begründen kann. Schöpfung, Konstruktion, Sein, aber auch postmentale
Strukturen ungeklärter Funktion könnten vorrangige Weltverhältnisse
begründen. Ein zentrales Prinzip ist die Autopoiesis, die vielleicht als
Selbstschöpfung bezeichnet werden könnte. Autodesign wäre etwa denkbar
als programmierte Selbstschöpfung in einem Rückkoppelungsprogramm, das
in dem Vollzug der Programmierung auch fortwährend das Programm verändert.
Es gilt danach nicht das Programm zu erkennen, sondern es zu vollziehen.
Autoprogrammierung des Programms. Entscheidend
ist aber, dass diese Entwicklungshypothesen nicht von dem Gedanken der
Entwicklung selbst ablassen. Mag sich der Mensch mit seinen Verlusten
abfinden, so sind doch die Prospekte, ob die von Moravec und anderer oder
die tradierter Gottesbilder, immer noch von einer Welt im Werden abhängig.
Das Programm ist nicht abgeschlossen, auch posthumane Existenzen haben
noch etwas zu tun. 4.
Raum, Zeit und andere Dynamiken Kant,
der durchaus ein Virtualist erteilte dem Virtuellen an einer Stelle
eine Absage: “Wenn man sich aber gar neue Begriffe von Substanzen, von
Kräften, von Wechselwirkungen, aus dem Stoffe, den uns die Wahrnehmung
darbietet, machen wollte, ohne von der Erfahrung selbst das Beispiel ihrer
Verknüpfung zu entlehnen: so würde man in lauter Hirngespinste geraten,
deren Möglichkeit ganz und gar kein Kennzeichen für sich hat, weil man
bei ihnen nicht Erfahrung zur Lehrerin annimmt, noch diese Begriffe von
ihr entlehnt” (KdrV, S. 251). Wäre Virtualität ein Konstruktionsmodus
ohne Erfahrung? Kant verwirft eine gegenwärtige Substanz im Raum, ohne
ihn zu erfüllen (Mittelding zwischen Materie und denkenden Wesen), Präkognition,
Telepathie (KdrV, S. 251). Kant war fraglos kein Science-Fiction- Leser
und hatte – etwa im Gegensatz zu Marvin Minsky - für Extrapolationen,
denen keine Erfahrung korrespondiert, keinen “Raum” in seiner
Transzendentalerkenntnis. Auch das Projekt der reinen Vernunft, die
transzendentale Begrifflichkeit, bindet
sich zuletzt an “unreine” Erfahrung zurück. Insofern ist auch die
Synthesis a priori alles andere als ein Weltschöpfungsprinzip, sondern
ein Erkenntnismodus der bestehenden Welt. Virtualität
will mehr und anderes. Es wäre festzustellen, dass die Form virtueller
Dinge von Erfahrung unabhängig ist. Aber lassen sich dann noch sinnvolle
Aussagen machen, die über die von Kant perhorreszierten
“Hirngespinste” hinausgehen? Sieht man großzügig über den
Existenzgehalt von virtuellen Erscheinungen hinweg, beobachten wir im
Anhub von cyberworld permanent Figuren und Szenarien, denen kein
simulativer Erfahrungsgehalt der Ausgangswelt entspricht. Diese
Erscheinungen können auch mit den von Kant verworfenen Eigenschaften
ausgestattet werden, weil alles virtuell gesetzt werden kann, solange
nicht ihre Existenz in der Ausgangswelt gefordert wird. Insofern wäre
etwa Telepathie als gleichzeitiger Gedankeninhalt von virtuellen Figuren
als Wahrnehmungsweise genau so konstruierbar wie alle anderen Weisen
nichtkörperlicher Wahrnehmungsmodi. Schwieriger
erweist sich dagegen die Frage, ob auch die Formen der Anschauung – Raum
und Zeit – konstruierbar bzw. erweiterbar wären. Nach Kant ist das
Schema der Wirklichkeit das Dasein in einer bestimmten Zeit. Da nun die
Virtualität nicht der Wirklichkeit folgt, sondern allein die Wirklichkeit
der Virtualität, kann auch die Zeit nicht von der Virtualisierung
ausgenommen sein. Andere Zeitparameter stellen dabei die geringste
Anforderung. Entwicklungsgeschwindigkeiten sind Rechnergeschwindigkeiten.
Bewegungsabläufe können verkürzt und gedehnt werden. Realzeit als Zeit
der Ausgangswelt wäre nur eine beliebige Größe gegenüber Zeiten. Auch
die Zeitmodi stehen einer Manipulation offen. Etwa kann der Zeitpfeil
reversibel gestaltet werden: Zukunft - Gegenwart – Vergangenheit.
Entwicklungsreihen zu ihrem Ursprung zurücklaufen.
Mehr
aber noch stellt sich die Frage, ob nicht neben oder außerhalb der Zeit
und des Raumes andere Dynamiken virtualisierbar sind. Raum und Zeit gelten
als Anschauungsformen und formale Bedingungen der Existenz. Bei der Frage,
wie diese Momente entstanden sind, bewegt sich jede Erkenntnis in einem
Zirkel, weil sie selbst just diesen Bedingungen unterworfen ist und ein
archimedischer Punkt, eine atopische oder atemporale Sphäre nicht
vorstellbar sind. Virtualität ist aber nicht an Erfahrung, Wahrnehmung
oder Vorstellung gebunden. Die Manipulation von Zeit als Reduktion lässt
sich leicht an einem Bild begreifen, das Zeit und Raum einfriert, cum
grano salis Ewigkeit prätendiert. Die “Mona Lisa” lächelt ewig –
der Augenblick wird zur Ewigkeit. Komplexer gestaltet sich der Entwurf einer extensiven Zeit und eines extensiven Raumes. Lassen sich virtuell Räume entwerfen, die n-dimensional sind und anderen Gesetzmäßigkeiten folgen als die Räume unserer Ausgangswelt. Räume, die übereinander liegen, ihre diskreten Grenzen verlieren, mit den Figuren verschmelzen? Diese Szenarien kennen wir aus Träumen, in denen die Subjekt-Objekt-Differenz, die aristotelischen Einheiten aufgehoben sind. Goedart
Palm |