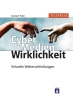|
|
|
Zwischen
Kannibalismus und Kantianismus Zum
Tod von Claude Lévi-Strauss Claude
Lévi-Strauss war der große Hexenmeister des Strukturalismus, der
zahlreiche Wissenschaftskonzepte seiner Zeit verarbeitete und mit seinen
brillanten Analysen weit über die Anthropologie und Ethnologie hinaus
berühmt wurde. Paradox formuliert war Lévi-Strauss der Strukturalismus
höchstselbst, während diese faszinierende
Mode der Welterschließung vom wissenschaftlichen Anspruch her doch bar
jeder subjektiven Signatur sein wollte. Lévi-Strauss wurde wegen seiner
hohen literarischen Qualitäten mit herausragenden Schriftstellern
verglichen, in die Philosophie eingemeindet und teilte das Schicksal
diverser französischer Intellektueller, nicht mehr auf eine einzige
„Disziplin“ festlegbar zu sein. Er orchestrierte seine Texte
musikalisch, etwa seine mytho-kulinarische Schrift „Das Rohe und das
Gekochte“, den ersten Band der "Mythologica“, die Referenzen
zur Tetralogie Wagners „Der Ring des Nibelungen“ expliziert. Der
Wissenschaftler will Werke schaffen, die musikalisch sind, weil die
Verwandtschaft von Mythos und Musik Epistemologien eröffne, die weit über
das hinausreichen, was bisher vorliege. „Die elementaren Strukturen
der Verwandtschaft“ schlägt 1949 wie eine Bombe in den französischen
Wissenschaftsbetrieb ein. Simone de Beauvoir feiert den neuen Superstar
in den „Temps Modernes“, um ihn gleich dem Sartreschen
Existenzialismus zuzuschlagen. Claude
Lévi-Strauss arbeitete aber anders als die Existenzialisten auf der
Schnittstelle von Natur und Kultur, jenem, auch politisch brisantem
Transformationsort, der wirkungsmächtig mit Rousseau in Philosophie und
Politik eingeleitet wurde. Dessen radikale Zivilisationskritik nahm
Claude Lévi-Strauss teilweise auf, um dem inzwischen anrüchigen
Kolonialismus auch die wissenschaftliche Rechnung zu präsentieren. Er
war der Auffassung, dass die Ethnologie seiner Bauart in der Lage wäre,
Kolonialdesaster, die aus dem überheblichen Nichtbegreifen fremder
Kulturen möglich werden, zu verhindern. Das Wissen um das wilde Denken,
das nicht weniger raffiniert gebaut sei als das vorgeblich aufgeklärte,
eröffnete einen völlig neuen Blick auf die traurigen Tropen. Die
Demontage des imperialen Blicks auf die Wilden lag in der Luft. Aber
erst Claude Lévi-Strauss hat ein multidimensioniertes Fundament in der
kritischen Nachfolge des Positivismus eines Auguste Comte und der
empirisch aufgerüsteten Soziologie Emile Durkheims vorgestellt, das vor
allem durch die linguistische Methode
geprägt wurde. Als die strukturalistische Mode blasser wurde, gab es
viele Denker, die eilig versicherten, alles, nur keine Strukturalisten
zu sein. Claude Lévi-Strauss dagegen war bekennender
Superstrukturalist. Er fahndete ständig nach Strukturen, die dem
jeweiligen Forschungsobjekt zugrunde lagen, von denen sich der
Wissenschaftler nicht ablenken lassen darf durch vordergründige Inhalte
der Mythopoiesis. Das intrikate Zusammenspiel der Elemente lernte Claude
Lévi-Strauss maßgeblich in Roman Jakobsons Linguistik-Vorlesungen, die
er als „eine Art Blendung“ erfährt und von Ferdinand de Saussure,
der die Arbitrarität der Zeichen betonte, die erst im System zu
„leben“ beginnen. Berühmt sind Strauss´ Untersuchungen über die
Verwandtschaftsbeziehungen und das Inzestverbot. Wurde das Inzestverbot
zuvor biologisch und moralisch interpretiert, bestand Claude Lévi-Strauss
darauf, dass die sozialen Konsequenzen dieses Instituts erst den
kommunikativen Raum konstituieren, der für den Fortschritt von
Gesellschaften selbstverständlich ist. Plastisch formuliert: Wer seine
Schwester heiratet, kann nicht mit seinem Schwager fischen gehen. So
wird das Inzestverbot ein prägnanter Ausdruck für die Umwandlung einer
vormals naturalistischen Betrachtung der Konsanguinität zu einem
zentralen Kulturmoment menschlicher Allianzen. Claude Lévi-Strauss hat
mit diesen Erkenntnissen auf der Schnittstelle von Natur und Kultur
einen nicht geringen Teil des wilden Bodens urbar gemacht und zugleich
die Kultur des Westens reflektiert. Dass wir selbst gegen jedes
Selbstverständnis Wilde bleiben, wurde später in einer weiten
Literatur zwischen Zeitgeist und Wissenschaft zum allfälligen
Untersuchungsgegenstand. Allerdings könnten diese Dezentrierungen der
europäischen Selbstgefälligkeit – wie immer – nicht die ganze
Wahrheit sein. Roger Callois hat sich mit Claude Lévi-Strauss
fundamental entzweit, weil dieser Strukturalismus die Unterschiede
zwischen den Kulturen ausblenden würde. Claude Lévi-Strauss würde
durch den Splitter im eigenen Auge daran gehindert, die Balken in den
Augen der anderen zu sehen. Kulturen, die Kannibalismus und andere
Widerwärtigkeiten kennen, würden hier künstlich aufgewertet, während
der Westen durch seine Neugier und seine Wissenspraxis diesen Kulturen
gegenüber überlegen sei. Claude Lévi-Strauss reagiert auf diesen
eurozentrischen Machtgestus sauer: Man möge sich nicht in der Küche
umsehen, um über Moral zu urteilen, sondern die Zahl unserer Tötungen
mit denen der Papuas vergleichen.
Psychologie,
Biologismen und ähnlichen Deutungsmustern wurde damit der Prozess
gemacht. Doch die abstrakte Kodierung der Mythologeme setzte sich dem
Verdacht aus, eine Art von Neo-Kantianismus zu predigen, der darin
besteht, das transzendental Kollektive wider die soziokulturellen
Differenzen zu konstruieren. Die Codierungen, die es aufzuspüren galt,
fanden sich programmgemäß über die Grenzen der jeweiligen Ethnien
hinaus, was aber für den Ethnologen nicht zum Verzicht auf genaue
empirische Beobachtungen werden darf. Ihre Regeln zu erkennen bedeute,
das System zu verstehen, nach dem Gesellschaften und Menschen
funktionierten. Der Ansatz war kühn bis kopernikanisch, weil von den
manifesten Inhalten gesellschaftlicher Selbstbeschreibungen nun auf
abstrakte Schaltungen der mythologischen Elemente umgestellt wurde.
Niemals wurde dieses entsubjektivierte Verfahren deutlicher als in der
späten lakonischen Aussage des buddhistisch inspirierten Meisters:
„Ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben keinen Sinn hat, dass
nichts irgendeinen Sinn hat“. Skeptiker
wie Claude Lefort sahen das kritischer, wenn er ein Grundproblem des
Strukturalismus formuliert: Die mathematischen Modelle verdrängten die
Wirklichkeit. Das Risiko, Modelle als Seinstatbestände auszugeben,
lauert bei allen Untersuchungen, die Phänomene symbolisch
„hochrechnen“, um nicht im „Realen“ zu ertrinken. Ausdrücklich
erklärt Lévi-Strauss im Bezug auf das Werk von Marcel Mauss die
Autonomie des Symbolischen wie des Signifikanten im Blick auf die Unabhängigkeit
der Sprache und der Verwandtschaftsregeln. Vielleicht konnte er das
Chaos der „frei flottierenden Signifkanten“ nicht voraussehen, die
sich gleichsam wie terroristische Viren in den postmodernen Körper
einschlichen, ja ihn letztlich substituierten. Denn so verdienstvoll die
Erkenntnis von Bedeutungsverschiebungen in der jeweiligen
artikulatorischen Praxis auch war, so blieben die
Standortbeschreibungen, in denen sie zu Bedeutungen, sprich:
Signifikaten, hätten werden können, in den späteren Aufgipfelungen
des Poststrukturalismus oft genug aus. Nicht nur Revolutionen, auch
Modelle können ihre Kinder fressen. Das
Verdienst Claude Lévi-Strauss´ bleibt indes die neue Sichtweise auf
die Konstruktion von Kulturen, deren Regeln tiefer gelegt sind, als es
die rationalen Rekonstruktionen und Selbstverständnisse zu wissen
glauben. Die strukturale Anthropologie hat immens zum Verständnis der
Kulturen und ihrer Kommunikationsweisen beigetragen, während die
konkreten gesellschaftlichen Bedingungen, die Entwicklungsunterschiede
und anderen Weltentfaltungsmomente nicht jederzeit zureichend gedeutet
werden können. Insofern sind Claude Lévi-Strauss Erkenntnisse in einer
globalisierten Welt weiterhin wertvoll. Welchen Codierungen folgen
islamistische Terroristen? Gibt es hier übergreifende Regeln, die sie
mit allen anderen Terroristen gemein haben, was konfliktgeladene Exkurse
in religiöse Dogmatiken bedingt wertvoll erscheinen ließe. Das Problem
der Wirklichkeit bleibt auch nach Claude Lévi-Strauss´ Erkenntnissen
ihre Unbotmäßigkeit gegen ihre Verortung im Spiel der Signifikanten.
Der Strukturalismus hat das Subjekt, den Menschen zugunsten von Codes,
Regeln, Ordnungen, Systemen verdrängt und das war zunächst heilsam,
doch hatte man die Rechnung ohne den Wirt gemacht, wenn das verdrängte
Subjekt für Dynamiken verantwortlich zeichnet, die in diesen Hallen der
strukturalen Anthropologie keinen Platz hatten. Der Strukturalismus ist
eine wissenschaftliche Episode geblieben, die im Höhenrausch eines
Paradigmas begann, um auf sperrige Wirklichkeiten zu treffen.
„Entkolonisierung“ könnte dieser Welterschließung nach in letzter
Konsequenz eine globale Maßnahme der Entsorgung der Erde vom
Menschengeschlecht heißen, da Claude Lévi-Strauss ähnlich wie Michel
Foucault das Ende der Welt nicht als Schlussveranstaltung des
selbstgewissen Menschen sieht. Ob daher der Strukturalismus humanistisch
ist oder nicht, mag angesichts der Absicht von Lévi-Strauss, die
Anthropologie in eine „Entropologie“, eine Wissenschaft von den
soziokulturellen Desintegrations- und Zerfallsprozessen zu verwandeln,
Stoff für endlose Räsonnements
liefern. Gegenüber diversen gegenwärtigen Fortschrittsnaivitäten
liefert dieses Konzept aber weiterhin zahlreiche Anregungen, hier bei
unseren zivilisierten Wilden nach der Auflösung sozialer Ordnungen und
ehedem approbierter Formen des Zusammenlebens zu fragen. Goedart
Palm |