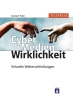|
|
Julian Barnes |
England, England |
| Kiepenheuer & Witsch 1999 |
Was ist typisch "british"? Jeder hat seine eigene Liste im Kopf, aber Megazampano Sir Jack Pitman verlässt sich auf eine Umfrage, die ihm die herausragenden nationalen topoi liefert. Sir Jack, eine Mischung aus pit-bull und turbokapitalistischem Geschäftsmann, plant einen Erlebnispark, der alle britischen Highlights, Tür an Tür, als konzentrierte Events einem erlebnishungrigen Weltpublikum bieten will. Die Isle of Wight wird zum Standort von "England, England" auserkoren. Aber schon bald avanciert das britische Disneyland vom historischen Kunstgarten zum hyperrealen England. "Echter als echt" scheint die Devise und selbst die Akteure wandeln sich von Schauspielern zu Protagonisten, die den historischen Figuren das wahre Leben einhauchen. Wer also England sucht, fährt nicht länger nach Großbritannien, sondern nach "England, England". Selbst die Royal Family emigriert ins virtuell-reale Szenario britischer Kraft und Herrlichkeit, Seite an Seite mit Robin Hood, Dr. Johnson oder der aufs Erlebnisformat geschrumpften Royal Airforce. Das reale England entwirklicht sich indes zu einer präindustriellen (Agri)Kultur, die Zivilisationsmüde, Gestrige und Looser beherbergt. Aber zuletzt bleibt offen, wo das bessere England liegt. Wirklichkeit oder Virtualität sind keine Maßstäbe fürs richtige Leben und Julian Barnes erweist sich als Dialektiker, der den Leser durch die antipodischen Welten führt, ohne ihm die letzte Option abzunehmen. "England, England" ist eine ironische Großmetapher der wirklichen Wirklichkeit, die in einer Welt virtueller Überbietungen zum Desiderat wird, ohne Hoffnung, letzten Aufschluss über die Heimat des Glücks zu finden. Längst sind wir alle aufbereiteter Vergangenheit, inszenierter Gegenwart und antizipierter Zukunft so oft begegnet, dass unsere Standortlosigkeit zum selbstverständlichen Fortschrittsmodus wurde. Goedart Palm |