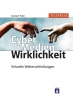|
|
Literaturtipps
|
|
| Das britische Empire: Geschichte eines
Weltreichs Peter Wende, 2008
Dieses Buch ist ohne Einschränkungen besonders lesenswert, weil es in der gebotenen Konzentration Herrschaftskonzeptionen darstellt, die eine zentrale Stelle in der Geschichte der Macht einnehmen. Geschichtsbetrachtungen sind standortabhängig. Die Zukunft ist der Standpunkt, der die vergangenen Geschehnisse nur vordergründig entzaubert. Hätte es nicht anders kommen können? Sind Kontingenzen eine Schicksalsmacht? Bevor das zu entscheiden ist, erkennen wir Strukturen, lösen uns von Akteuren, so mächtig ihre historische Wirkung auch erscheinen mag. Der Impuls der Macht und der Widerstand der Freiheit, gekoppelt mit zahlreichen heterogenen Interessen sind in diesem letzten großen „Empire“ zu verfolgen. Michael Hardt und Antonio Negri haben in Empire – die Neue Weltordnung den spätmodernen Heuschrecken-Kapitalismus als differenzloses Reich einer totalen Globalisierung angeprangert. Doch die Begrifflichkeit des „Empire“ ist hier nur ein kategorisch fragiles Lehnwort, das eine völlig andere Struktur, eine Identität im Nichtidentischen beschreibt. Ganz anders funktionierte dieses von Peter Wende beschriebene Empire in seinen verschiedenen Phasen, in denen die Bindungsmassen gesucht, beschworen und verloren wurden. Wer heute Europa in historischer Absicht besucht, kann ohne die Rekonstruktion dieses Ideengeflechts die Beziehungen der Nationen nicht wirklich verstehen. Hätten einige Staatsmänner sich mit den Weltbeglückungstheorien und Selbstbereicherungsmethoden des vormaligen „Empire“ detaillierter befasst, hätte sie das vielleicht vor törichten Missionen bewahrt, deren hypothekarische Lasten gegenwärtig abgetragen werden müssen. Menschen genesen nicht am fremden Wesen, weil jene es wollen, sondern allenfalls, weil es sich im Vollzug selbst plausibel vermittelt. Das zeigt Wende sehr schön: In welche Antinomien und Paradoxien Herrschaft gestürzt wird, die ihren eigenen Anspruch idealisiert und nicht wünschen kann, dass die Unterworfenen diesen Lehren auch wirklich folgen. Insofern ist der Imperialismus immer schon das Heilsrezept gewesen, das seine Selbstabschaffung mitlieferte. |
| Arthur Koestler, Als
Zeuge der Zeit: Das Abenteuer meines Lebens
Das Buch fand ich in der Remittendenkiste. Fragiler Kaufgrund: Koestler, könnte man mal reingucken. Kindheit, na ja, mittelmäßig interessant, aber gleichwohl weiter gelesen. Dann folgen die Berichte über die Russland-Reise, die Abkehr vom Sozialismus, über den spanischen Bürgerkrieg, die Flucht in Frankreich und die Internierung in Le Vernet. Ein normales, also anormales Intellektuellenschicksal, geprägt von heftigen Ideologien und ihrer gefährlichen Praxis. Flucht, Krieg als Dauerbegleiter. Wer Anschauungsunterricht über die Abgründe der menschlichen Existenz benötigt, ohne Larmoyanz, ohne narzisstischen Bekennereifer, kann hier viel lernen. |
|
Rodney Brooks, Menschmaschinen. Wie uns die
Zukunftstechnologien neu erschaffen
Brooks war mir schon vorher aufgrund einiger öffentlicher Statements bekannt. Das Buch umreißt gut eine Position, die mir sympathisch ist, weil er ein unaufgeregter Zeitgenosse ist, der in zahlreichen Ansätzen überzeugt. Ohnehin bewege ich mich in demselben Lager, weil ich auch Theoretiker nicht ernst nehmen kann, die dem Menschen eine - überzeitlich - einzigartige Stellung in der Welt einräumen. Geht man von dieser Prämisse aus, ergibt sich der Rest fast wie von selbst. Ein
Online-Text zum Thema von Goedart Palm unter Telepolis >> |
| Gabriel Sénac de
Meilhan
Lese gerade die "Considérations sur l'esprit et les mœurs" in englischer Übersetzung und die "Neuen Briefe" des Prinzen de Ligne. Wie weit sind wir davon entfernt? Ist Weisheit ein Habitus? Lassen sich die Erkenntnisse in eine wissenschaftliche Psychologie integrieren oder erkennen wir, wie weit die zeitgenössische Wissenschaft von bestimmten Erkenntnissen noch entfernt ist. |
|
Zu Urheberrecht und anderen Rechtsfragen:
|