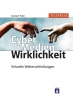|
|
Aporien der Zeitherrschaft
|
- Teil 2 - |
6. Zukunft als souveräne Zeittechnologie a. Demiurgen der Zeit Der verschlungene Weg von der Religion über die deutschen Meisterdenker zum Holocaust steht paradigmatisch für Glaubens- und Wertverluste. Neue und alte Irrtümer bleiben die Wegmarken geschichtlicher Bewegung. Vor diese apathischen Apokalypsen und stimmlosen Abgesänge der Zukunft stellten sich die mächtigen Propheten der neuen Medien, die Herrscher der Hypertechnologien und Informationsimperien. Ihre Aufbrucheuphorie kennt keine Grenzen. Machbarkeit von Zukunft, schwerelose Existenzen ohne den Fluch der Vergangenheit, Geschichtslosigkeit im Zukunftsglauben werden beschworen, sedimentieren sich in Politik, Werbung und anderen profanen Frohbotschaften. Mit der Brüchigkeit alter Zeitherrschaftsformen rückt Technologie aus der Rolle des menschlichen Instruments zum stärksten Hoffnungsträger sozialer Wandlungen vor. Mögen wissenschaftliche Paradigmen wechseln, Ikarus in immer neuer Gestalt den lebenserhaltenden Luftkorridor verlassen, erhält sich doch die Ideologie einer ungebrochen evolutionären Technologie. Die biologische Evolutionsgeschichte endet, sie wird abgelöst von einer künstlichen Evolution der Maschinen, Apparate, Computer. Die uns prägende Differenzierung zwischen Natur und Naturbeherrschung wird im vorübergehenden Paradox einer künstlichen Natur, einer zweiten Natur eingeebnet. Zielpunkt dieser Geschichte wäre eine Technologie, die omnipotent ist. Diese Technologie wäre weder menschen- noch geschichtsabhängig, würde Zeit und Raum gleichermaßen vollkommen beherrschen, die Zeit würde reversibel, befreit von ihren klassischen Modi. In dieser Vision ist Vergangenheit und Befreiung von ihr gleich gültig. Und die neuen Zauberlehrlinge bringen die Deckungsmasse ihrer zeitlosen Versprechungen gleich mit. Ihre Konstrukte, die Abakus, Pascals Rechenmaschine, Charles Babbages "Analytical Engine", mechanische Schachspieler und alte Lochkartenherrlichkeit weit hinter sich lassen, werden schlicht als Rechner präsentiert, aber in ihrem Gepäck führen sie das Versprechen eines digital eingerichteten Paradieses mit sich. Wer aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließt, wird dem keinen ungeteilten Glauben schenken. Hat sich die Zukunft der Katastrophen doch nie von den gegenwärtigen Remeduren besänftigen lassen und haben die neuen Zauberlehrlinge ihre Störanfälligkeit bereits zu Genüge unter Beweis gestellt. Selbst die simpel erscheinende Uhrumstellung auf das neue Jahrtausend begründet millenaristische Ängste, weil Euroamerika fremde Zeitordnungen wenig zur Kenntnis nimmt. Die boshafte Dialektik einer Geschichte, die neue Erreger ersinnt, wenn alte geschlagen sind, Aids und Krebs gegen Pest und Cholera eintauscht, mag den technologischen Zugriff auf ihre Zukunft nicht fürchten. Ja mehr: Chaos, Entropie, Zerstörung sind stärkere Prinzipien als eine funktionale Vernunft, die sich dem entgegen stemmt. Jede Beschreibung dieser Zukunft scheitert an unseren endlichen, dem Tod geweihten Perspektiven. Unsere Stellung in der Geschichte bleibt gebunden an Werden und Vergehen. Wurde der Traum vom Fliegen Wirklichkeit, so ist der Traum vom ewigen Leben noch Desiderat. Waren früher die Religionen zuständig für die posthume Einlösung dieses Wunsches, sind jetzt posthumane Technopropheten angetreten, dieses Ziel zu verwirklichen. b. Neue Körper braucht die Zeit Inzwischen will die Wissenschaft im Diesseits das Leben gegen das Jenseits versichern. Die "Extropians" gar fordern das ewige Leben. Der Tod gilt als Schande, als die Umkehrung der menschlichen Ordnung - eine Klage, die schon das Gilgamesch-Epos führt: "Als die Götter die Menschheit erschufen, teilten den Tod sie der Menschheit zu, nahmen das Leben für sich in die Hand." Natur als Zeitbetrug am Menschen. Auch wenn das Paradox, dass sich die Natur gegen die Natur wehrt, unübersehbar ist, präsentieren sich die Extropians nicht als Mythenbrüter, sondern als technikgläubige Rationalisten. Das vormals von Sozialutopisten reklamierte Ziel eines irdischen Paradieses verwandelt sich ihnen zu einem überirdischen Paradies mit irdischer Technik. Wie in allen Utopien so gibt es auch hier keine Katastrophen, Krankheiten oder andere Unbill mehr. Der Mensch soll zum Menschen werden, weil er nicht länger (nur) Mensch ist. Transhumanität buchstabiert sich als artifizielle Körperlichkeit, die nichts weniger als ein biologisch fragile Konstruktion mehr sein will. Der Körper wird medizinisch, elektronisch, digital und virtuell bis zur Nichterkennbarkeit aufgerüstet - ewiges Leben wird zur Selbstverständlichkeit. Extropie ist die selbstgewisse Antwort auf Entropie, jene Kategorie, die Chaos und Tod repräsentiert. Die Alcor Life Foundation erhält die Körper, wenn die leider noch allgegenwärtige Entropie - etwa in Form eines fallenden Ziegelsteins - dem Prinzip Hoffnung vor der Zeit ein Ende setzt. Eingefroren in künstlichem Stickstoff lagern die Leichen langfristig bis zum Tag der Wiederauferstehung, die nicht mehr von Gott, sondern göttlicher Technologie besorgt wird. Invasive Nanotechnologie heißt der vorläufige Zauber der Zeitherrschaft. Zwergroboter bevölkern den anfälligen Körper, reparieren ihn immer wieder, sodass nicht einmal das Bildnis des Dorian Gray nötig ist, um ihn auf ewig jung und schön zu halten. Auch wenn das wie Nivea-Werbung der Zukunft klingt, haben sich inzwischen namhafte Wissenschaftler den Extropians angeschlossen. Der Roboterprophet Hans Moravec hat die "Mind Children" der Zukunft schon beschrieben: Der Geist, jenes flüchtige Wesen, wird in den Computer gespeist und hochgetaktet. Da das Gehirn physikalischen Gesetzen gehorcht, können diese auf einem Rechner simuliert werden. Nicht nur wird die Lebenszeit unendlich, sie wird auch unendlich leistungsfähiger. Vor dem Datenkollaps schützt die Sicherungskopie den transhumanen Datenbankgeist. Was bleibt vom "homo classicus"? Nach den Extropians werden die biologischen Menschen zu musealen Wesen, die kein großes Interesse mehr auf sich ziehen. Die Zukunft befreit sich von der Vergangenheit, von jenen Mängelwesen, zu denen wir zählen. Der transhumane Typus verabschiedet sich von menschlichen Zwecken und Zielen. Mit der Vision verknüpft sich die Polemik gegen entropische Politik, die mit alten Mitteln neue Probleme lösen will. In diesem Konzept verschmelzen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zur Ewigkeit. Aber nicht nur das: Die Identität, Hort der Vernunft, wird zu einer subjektlosen Kategorie. Die Wesen mit dem rasanten Speicher verarbeiten sich selbst zu ständig neuen Konstruktionen. Diese "apocalypse light" reitet nicht länger im Fluch Gottes über schwaches Fleisch, sondern schafft aus neuem Lehm paradisische Existenzen. Aber auch dieser Vorschein von Hyperwesen, jenseits menschlicher Gebrechlichkeit und Todesgewissheit, führt nur einen alten Mythos mit neuen Mitteln fort. Mircea Eliade hat auf das archaische Bedürfnis hingewiesen, die profane Zeit zu sakralisieren, um sich so in einen zeitlosen Urzustand zurückzubegeben. Archaische Systeme seien Ausfälle gegen die historische Zeit, Vernichtungen, die gegen das Erinnern gerichtet sind. Auch wenn Eliades These im Hinweis auf die ägyptische Konservierungsbesessenheit kritisiert wurde, ist der zeittranszendierende Mythos der ewigen Wiederkehr eine alte Zeitbeherrschungsfantasie. Chinesische Alchimisten wollten natürliche Verfallsprozesse radikal verlangsamen, um Unsterblichkeit zu erreichen, während ihre europäischen Kollegen den prosaischen Fürstentraum von der Verwandlung unedler Metalle in Gold träumten. Das ewige Leben des Extropians ist ein noch nicht Fleisch gewordener Widerspruch, weil Leben Werden ist und allein der Tod Ewigkeit reklamieren mag. Dem Konzept des nachgeschöpften Golems fehlt die Fantasie für den diabolischen Erfindungsungeist der Katastrophen. Indem diese Fortschrittsgläubigen ihre Zukunft von jeder Vergangenheit befreien, verkümmert zugleich das Wissen um die Fehlsamkeit jeder Schöpfung. III. Vom Chronozentrismus zu neuer Zeitsouveranität 1. Aufdringliche Vergangenheit Sollten wir uns also an die Gegenwart halten, die wir ja immer besitzen zu scheinen, um aus den Irrungen und Wirrungen der Vergangenheit, aber auch den Prospekten einer verführerischen Zukunft herauszutreten? Was ist Gegenwart? Johann Gustav Droysen erkannte in jedem Punkt der Gegenwart seine ideelle Vergangenheit. Aufgabe des Historikers sei es, sie wieder zu erwecken, sie aufleben zu lassen. Verkürzt: Jede Vergangenheit hat eine Option auf die Zukunft - das, was in der Geschichte nicht erloschen ist, wartet auf seine Wiedergeburt in der Gegenwart. In der Gegenwart werden ideell Zukunft und Vergangenheit zu einem Kontinuum zusammengeschlossen. Der Blick zurück im Blick nach vorn emanzipiert die Gegenwart von ihrem fatalistischen Zustand, nur ein berechenbares Durchgangsstadium der Zeit zu sein. Darin finde der "endliche Geist" ein Analogon der Ewigkeit. Aber gilt das auch für unsere Gegenwart? Uns gilt die Zukunft als Gegenwartsaufgabe, die in ganz anderer Weise Vorstellungen, Hoffnungen und Wünsche mobilisiert, als es der Rückblick in eine vorgeblich abgeschlossene Vergangenheit vermag. Gegenwart schwimmt wie eine Insel im Meer dieser Zeit, aber die Aggressivität des Meeres wächst, die Insel wird punktförmig, um irgendwann vielleicht ganz zu verschwinden. Wer die Gegenwart gegen den Salzfraß der Zukunft retten will, fällt in Vergangenheiten zurück, die nicht länger lebendiges Erfahrungsmaterial bereithalten, sondern Fossilien, Souvenirs einer toten Zeit - aus- und abgelebt. Einstiges Erfahrungswissen verkümmert bei schwindenden Halbwertszeiten zum Ballast. Aber das ist nicht die Wirklichkeit subjektiven Zeitbewusstseins. Sigmund Freuds Vergleich des Unbewussten mit einer alten Stadt, in der sich verschiedene Schichten historisch sedimentiert haben, bringt das Verhältnis von vorauseilender Zeit und verfallendem Raum auf einen anderen Punkt: Räume besitzen eine Zeitstruktur, sind mit geronnener Zeit aufgeladen. Ist Denkmalschutz die Gebäudeversicherung gegen den Zahn der Zeit, zielt die Psychoanalyse auf die Urbarmachung des Verdrängten. In der Psychoanalyse soll die Zukunft des Kranken von einer unbewussten Vergangenheit befreit werden, um sie mit seiner Gegenwart zu versöhnen. a. Zeitstürmer intra portas Baron Haussmann verordnete Paris dagegen "demolition". Das alte Paris, mit Ausnahme historischer Glanzpunkte, sollte nicht urbar gemacht werden, sondern der Metropole der Metropolen weichen. Die Gegenwart Napoleon III. befreite sich im Rundumschlag von einer Vergangenheit, die nicht mehr die Fassaden der Zukunft prägen sollte. Plattenbauideologie, Wohnsilovorstadtwüsten und Betongärten hilfloser Humanität riefen auch weiterhin nach Demoliteuren, um obsolete Historie in der Gnade des sozialen Wohnungsbaus zu entsorgen. Stadtmörder und Architekturstürmer wandelten sich zu Stadtsanierern. Mannigfaltige Kriterien wurden entwickelt, um konservierungswürdige Geschichte und dem Fraß der Zeit vorgeworfene Vergangenheit zu trennen. Dieses Dualsystem eines neuen Ökohistorismus, selbst der Geschichtlichkeit ausgesetzt, wurde nicht nur zum Sprengstoff der Stadtplaner, sondern aller, die glaubten, diese Welt von ihren Kindern geliehen zu haben. Im Streit um einen konsensfähigen Kanon der Erhaltungswürdigkeit wird die Ungleichzeitigkeit der Zeitgenossen selbst zur Ideologie. Lehrt uns die Geschichte noch etwas oder können ihre Archive getrost geleert werden? Längst wissen wir nicht mehr, welchen kognitiven Mehrwert die Vergangenheit für die Zukunft haben könnte. Schulwissen, das aus der Geschichte Erfahrung destillieren will, verkümmert selbst zum Beleg überalterter Bildungskonzepte. Historisches Wissen, regelmäßig für geschlossene Gesellschaften und überschaubare Örter brauchbar, kapituliert vor globalen Problemen, die nicht auf eine vorgelebte Geschichte rekurrieren können. In den Paradoxien der Neuzeit ist Geschichtswissen bescheiden geworden. Vergangenheit wehrt sich inzwischen auf hedonistische Art gegen ihr Los, keine Zukunft zu haben. Zurück, nicht allein zur Natur, sondern zur Geschichte, so lautet der spätromantische Imperativ, der Arm in Arm mit dem Fortschrittsglauben daher schreitet. Diese Vergangenheit wird von Zukunftsverantwortung befreit, sie gilt nur noch in ihrer phänomenologischen Erlebnisform als bessere Zeit. Folgerichtig, aber folgenlos ästhetisieren mächtige Erlebnisindustrien Geschichte als vergnügungsträchtigen Abenteuerspielplatz. Geschichtsmuseen und Denkmäler sprießen - Reminiszenzen wider den Zeitdruck der Zukunft: Disney World überbietet die Geschichtsklitterungen Ludwig II. in taktilen Plastikwelten. Zeiten und Örter werden simultan inszeniert, aus dem Gefüge der Zeiten herausgerissen, angereichert mit geschichtslosen Argonauten der Comic-Word, weil erlebnisheischende Geschichtstouristen sieben und mehr Weltwunder zwar berühren, aber nicht begreifen wollen. Zukunftsvernarrten Japanern gar ist ganz Europa historischer Wallfahrtsort im Agfachromformat. Schwerelose Nostalgie wird im Zuge ihrer technologischen Virtualisierbarkeit zur Glasur von Zukunftsgesellschaften. b. Mnemosyne: "Revolutio" der Erinnerung Erinnern heißt Vergessen - denn anders würde sich keine historische Gestalt aus der Geschichte bilden. Zeitgenössische Berufshistoriker kennen das formlose Elend hypertrophen Informationswachstums: Richtiges Vernichten wird wichtiger als die Totalisierung der Reliktmengen. Wenn Geschichte das Leben des Gedächtnisses ist (Cicero), muss das Gedächtnis immer wieder von Vergangenheit befreit werden, um eine lebendige Vergangenheit für die Zukunft zu bewahren. Was ist Erinnerung? Der "Tigersprung in die Vergangenheit" (Benjamin) gilt klassisch als zeittranszendierender Modus und zeitunterworfener Mythos zugleich. Im Auge des Tigers bündeln sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht als geschichtsphilosophisch diskrete Zustände, sondern werden zu zeitübergreifenden Bildern verschmolzen. Zukünftigen - Trendforschern, Futurologen und Cyberpunks - sind Erinnerungen dagegen Ballast. Sie entwerfen auf dem Reißbrett eine Zukunft, die auf uns zurast, mit einem kurzen Zwischenaufenthalt in der Gegenwart, um in der Vergangenheit dem Vergessen ausgeliefert zu werden. In der Paradoxie spätmoderner Zeitherrschaft wird Vergangenheit aber gleichzeitig gehindert zu vergehen, wenn ihr digitales "backup" jederzeit Vergegenwärtigung ermöglicht. Schon im römischen Bild des Januskopfes, der gleichermaßen in Zukunft und Vergangenheit blickt, lag eine bündige Metapher vor, in einem Bewusstsein alle Zeitmodi zu verbinden. Elektronische und digitale Medien schließen aber weit imperialer die Zeiten kurz. Retrospektion und Prospektion vermählen sich zu einem panoptischen Blick durch Geschichten, in denen Aufzeichnungssystem und Zeitmanipulation eine untrennbare Verbindung eingehen. Aus der Heteronomie einer unwandelbaren Vergangenheit emanzipiert sich die relative Autonomie menschlicher Herrschaft über Erinnerungen. In der Herrschaft technokannibalistischer Speicher entstehen gewaltige historische Reliktmengen, eine ausufernde Genealogie vergangener Ereignisse - jederzeit und überall abrufbar. Weder zyklische Radzeit noch lineare Stromzeit sind in dieser Gleichzeitigkeit existent, sondern nur noch die Allgegenwart von Speicher und Schirm herrscht. Ob Reichsparteitag, Fußballweltmeisterschaft oder Mauerfall, in neuen Medien werden Ereignisse zu patch-work verarbeitet, der grellbunte Flickenteppich aus Geschichten könnte so oder anders gewirkt sein. Weit auseinanderliegende Gedächtnistopografien werden überblendet und prätendieren Zusammenhänge, die keine sind. In dieser wachsender Zeitsouveränität des Erinnerns dehnt sich Paul Feyerabends antimethodische Regel "anything goes", zum "anything goes always" aus. Nicht nur in Speicher und Traum laufen die Zeiten ineinander, halten Tote und Lebende Rücksprache, auch im Gedächtnis ist viel Platz für Ewigkeit. Zwar hat Nietzsche dem Stolz die Kraft attestiert, das Gedächtnis zum Nachgeben zu bewegen. Widersprüche zwischen unseren Erinnerungen und den Beweisstücken objektivierter Gedächtnisspeicher provozieren aber die Schwäche dieses Stolzes. Spätestens seit dem Aufkommen der Schrift synchronisieren sich privates und öffentliches Erinnern nicht reibungslos. Mit der Zeit leben heißt zugleich, gegen andere Zeitbilder, andere Erinnerungsansprüche und fremde Vergangenheiten zu leben. Die zeitgenössischen Anstrengungen, den Holocaust zu erinnern, belegen den Kampf der Erinnerung gegen die verrinnende Zeit, die auch das vergessen lässt, was nicht vergessen werden darf. Gleichwohl festigt sich in diesem Anspruch keine einigende Erinnerungskultur, um dem Grauen zukunftsverbindliche Symbole zuzuordnen. Der Streit um das Berliner Holocaust-Denkmal wurde selbst zum Denkmal dafür, dass ein Denkmal nicht länger ausreichen mag, das Unfassbare symbolisch zu fassen. Steven Spielbergs Shoah-Foundation sammelt dagegen alle noch verfügbaren Zeugnisse, nichts soll durch den kalten Rost der Erinnerung dem Vergessen des Feuers anheim fallen, von der Gnade der späten Geburt exkulpiert werden. Über 49.000 Augenzeugenberichte bilden gegenwärtig ein elektronisches Archiv, das gleichsam die Arbeit jenes britischen Schuldeintreibers, des "remembrancers" (Peter Burke), übernimmt: Das zu erinnern, was seine Kunden gerne vergessen würden. Aber auch dieser Zugriff auf die Erinnerung befreit nicht von der Frage nach der angemessenen ars memorativa, der Erinnerungskunst, um die Zukunft von der Vergangenheit zu befreien, ohne die Fakten in den elektronischen Akten zu beerdigen. 2. Flüchtende Gegenwart
Erinnerungskunst war vordem selbstverständliche Alltagspraxis. Der Renaissance diente das Nachbild der römischen Geschichte als Vorbild und Planungsanleitung der Zukunft. Das vergangene Bild der "Gegenwart" konturierte sich zu einem Zeitraum konstanter Lebensbedingungen. Jene vergangene Gegenwart erstreckte sich vom Jetzt bis zu einer eineinhalb Jahrtausende zurückliegenden Vergangenheit. Selbstverständlich war, dass die Vergangenheit sich als Lehrmeisterin der Zukunft gerierte. Voraufklärerischer Zeit war danach Aufklärung kein Ausgang zu einer besseren Zukunft, sondern ein Rückschritt, um den Fortschritt zu beflügeln. Mit dieser pragmatischen Fiktion einer ausgedehnten Gegenwart, die auf der Ungenauigkeit, aber vor allem Unnötigkeit menschlicher Veränderungswahrnehmung basierte, erwuchs dem subjektiven Zeitbewusstsein ein Zeitherrschaftsglaube, der in der Beschleunigungsspirale der Geschichte sukzessive zerstört wurde. Ist die gegenwärtige Gegenwart dazu verurteilt, zur Schwundstufe ihrer Vergangenheit zu werden? Mit wachsender Innovation zieht sich der Zeitraum einer konstant bestimmbaren Welt zusammen. Das Vertrauen in die Gegenwart fiel in die Zeitfalle; die Gegenwart selber eskamotierte sich, weil sie immer nur unvollkommen besitzt, was in den Zukunftsprognosen schon als zukünftige Wirklichkeit besessen wird. In den Verlockungen der Zukunft kann Gegenwart nur noch als überflüssiges Durchgangsstadium verstanden werden. "Verweile Augenblick, du bist so schön" wagt keiner mehr zu sagen, weil alle Zukunft in den Trivialprophetien tausend Mal schöner ist als die Gegenwart je sein kann. Wer in der Gegenwart verharrt, gilt euphorischen Zukunftsvisionen schon als Vergangener: Zukunft als zeitlose Mode der Gegenwart - eingedenk Daniel Burrus´ paradoxer Lakonie "Die Zukunft wird nie wieder sein, was sie einmal war." Geschichtsschwund und Zukunftsinvasion, die nach Hermann Lübbe Gegenwart schrumpfen lassen, gelten der Cyberkultur aber längst nicht mehr als ultimative Zeitdiagnose. Die vormalige Trennung der Zeiten, schon in historischen Zeitkonzepten so durchbrochen, dass es weniger ein Grundsatz als eine pragmatische Hilfskonstruktion war, kollabiert modernen Temponauten vollständig. Nicht nur die Körper, auch die Zeitmodi sollen virtuell werden. Virtualität wurde nicht zuletzt auf Grund der spielerischen Erscheinungen in cyberspace als eine Art postmodernes Illusionstheater mit anderen, nämlich digitalen Mitteln begrüßt. Auch der Zeit wurde folgenreich von McTaggart bescheinigt, eine Illusion zu sein: "Ich glaube, dass die Zeit irreal ist." Kein Wunder, dass der Kurzschluss von Virtualität und Zeitlichkeit die Gegenwart in den status irrealis versetzt. Virtualität ist aber mehr als die Fortsetzung der Wirklichkeit mit illusionären Mitteln. Wir begegnen dem neuen Modus der Überzeitlichkeit. Zeit wird plastisches Material. War zuvor der Film der mediale Vorschein auf eine Neuordnung der Zeitstruktur, purzeln in der virtuellen Totalkonstruktion von Welt und Welten die tradierten Zeitmodi vollends durcheinander, sind Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft grobe Klötze gegenüber simultanen Räumen, die jede Zeit speichern und produzieren - jederzeit...Wenn alles so oder anders gestaltet werden kann, schrumpft aber nicht nur die vormalige Zeitsicherheitszone "Gegenwart" als Differenz von Vergangenheit und Zukunft. Auch der Mensch, dessen (Körper)Identität von zyklischen Zeiterfahrungen abhängig ist, verliert im Strudel manipulierbarer Zeiten seine Haltegriffe. Mit der Geburt des "Eurotaoismus" aus dem Geist spätmoderner Geschichtsbeschleunigung beginnt die Suche nach Bewusstseinsformen, die nicht länger nach heute und morgen fragen, sondern sich eine zeittranszendente Gegenwart sichern wollen. Aber diese Selbstvergegenwärtigung der Erleuchtung will Späteuropäern selten gelingen. Während Buddhismus, Taoismus und ihre trivialen Spielarten im "Newage" den Menschen vom Zeitjoch befreien wollen, stehen westliche Mentalitäten in der Tradition, die Zeit auszuschöpfen, sie zu strukturieren und rationalisieren, um die Welt zum Besseren zu wenden. So rät der Dalai Lama in seiner millenaristischen Ethik für das dritte Jahrtausend orientierungshungrigen Westlern vom Weg zur Erleuchtung im "Hier und Jetzt" ab. Aber selbst diese klassische Polarität zwischen Okzident und Orient, die gestern noch galt, sagt einer bewusstseinsschwachen Zerstreuungskultur heute nicht mehr viel, die Erleben als instantane Lust sucht, ohne länger nach Selbst und Welt zu fragen. Das geschichtslose Erlebnis kennt weder Zeitmodi noch "sartori". Für die Kinder von MTV, Love-Parade und Crack hat die Herrschaft der reinen Instantanität begonnen: Ekstase statt Erleuchtung heißt die Zauberformel juveniler Zeitherrschaft. 3. Zukunftsberauschte Gegenwart "In einer Welt ohne Zukunft ist jeder Abschied eines Freundes ein Tod, jedes Lachen das letzte Lachen. In einer Welt ohne Zukunft liegt jenseits der Gegenwart das Nichts, und die Menschen klammern sich an sie, als hingen sie an einer Klippe" (Alan Lightman). Diese von der Zukunft befreite Gegenwart bleibt uns erspart, ja ist nicht einmal vorstellbar, da unsere Zeitmodi nur im verschlungenen Wechselspiel unserer Existenz Sinn geben. Unsere Zukunft öffnet ihre Tore weit und das Neue lockt mit Glanz. Die Wertschätzung des Neuen lässt sich zwar retrospektiv datieren, aber seine Erscheinung sperrt sich gegen kausale Rekonstruktion, es taucht plötzlich und folgenreich auf. Evolutionstheoretiker sprechen von Emergenzen - Erscheinungen in der Zeit ohne lineare Provenienz. Kreativität und Genialität werden zu Begrifflichkeiten, die verdecken helfen, was im Zeitpunkt seiner Erscheinung nicht erklärbar ist. Setzte man in der Renaissance auf die Priorität des Alten, entlasten die Strukuren moderner Staatlichkeit die Beharrung auf Vergangenheit. Das Entstehen von Territorialstaaten führt zu höherer Beständigkeit des Gemeinwesens. Bessere Anschlussmöglichkeiten von Kommunikation stärken die Individualität gegenüber der Gesellschaft. Emanzipation bei gleichzeitiger Vergesellschaftung des Individuums werden zu relativen Sicherheitsgaranten gegenüber den Untiefen des Fortschritts. Die barbusig aggressive Freiheit auf den Barrikaden revoltiert schließlich gegen die Vergangenheit, weil die Zukunft so gewiss wird, wie es die Vergangenheit den Altvorderen war. In diesem Siegeszug des Neuen, dessen vorläufigen Höhepunkt wir in einem Heute, das schon morgen sein will, erleben, verändert sich auch das Verhältnis der Zeiten zueinander. Ist Vergangenheit je nach Deutungsmuster und Beobachter Konstruktion, muss es die Zukunft erst recht sein. Neuheit, ehedem beargwöhnt und einem nacheilenden Verständnis unterworfen, um es als das Alte ausweisen zu können, wird zur Obsession. Zukunftswerkstätten wie die "Expo 2000" beschwören, was früher göttlicher Funke war. Das Neue tritt mit Macht in die Geschichte ein, um aber sogleich zu kollabieren, es wird redundant und provoziert den Wunsch nach "neuem Neuen". Die Gegenwart wird in dieser Beschleunigungsspirale instabil, permanent entstehen neue Zukunftsszenarien, die uns in das Wechselbad von Hoffnungen und Ängsten werfen. Der Zukunftsdiskurs der Gegenwart steuert in chronische Aporien. Welchem Glauben an die Geschichte folgt man? Gentechnologie - Machwerk des Teufels oder Segen für die Menschheit? Informations-technologie - Ende humaner Zustände durch Datenherrscher oder ultimative Einlösung aller Kommunikationsfantasien? Politische Programme versagen sich zwar die Ankündigung des Paradieses, aber zumindest ist morgen alles besser als heute, weil die träge Vergangenheit und die Gegenwart als ewiger status nascendi entmachtet werden. Das paradoxe Fatum der so schicksalslosen Gegenwart besteht in ihrer Schwäche, die selbstgeschaffenen Herausforderungen aus dieser quälenden Spannungslage zu befreien. 4. Ich-Zeit-Souveränität: Le temps c’est moi a. Kultur der Langsamkeit Im technologischen Umbruch der Zeitmodi und der Innovationssucht erleben wir heute den vorläufigen Höhepunkt eines Chronozentrismus, der klassische Zeitregimenter weit hinter sich lässt, ja mehr, aufsaugt. Fremd- und Eigenzeit werden verwischt, globale Entfernungen verwandeln sich in digitale Sekunden, audiovisuelle Medienfeuerwerfer bombardieren stammesgeschichtlich träge Sensoren, genetisch gebrechliche Zeitwesen weichen vorgeblich unsterblichen Hyperwesen...und unser müder Körper hinkt hinterher. Im Jetlag revoltiert er gegen den "Betrug" der Fortbewegung des unbewegt Reisenden - Goethe konnte sich noch den Luxus des Parnass-Bewohners leisten, über Wahrnehmungsverluste beim Kutschentempo zu klagen. Heute hinterlassen Reizüberflutungen eine gepeinigte Psyche - "burned out" lange vor dem biologischen Ende. Behaupteten traditionelle Lebenswelten eine Kontinuität der Örter, basierten auf einer Raumerfahrung der Verbundenheit (André Levi-Gourhan), erschließen sich nicht nur spätmodernen Cybernomaden Zeiträume als diskontinuierliches Erfahrungsfeld - dabei "er-fahren" wir nicht mehr in gemächlicher Kontemplation vorbeiziehender Örter unsere Identität, sondern allenfalls retrospektiv will es uns gelingen, Sprünge in der Zeit zu einem unvollständigen Mosaik persönlicher Geschichte zu wirken. Eine vorbehaltlose Kritik der Beschleunigung läuft indes Gefahr, sich naiv gegen einen evolutionären Wandel der Zeit zu verwahren. Kritik der Zeit in der Zeit kann nur heißen, gegenwärtige Zeitparadigmen auf Veränderlichkeit hin zu überprüfen, Zeitsouveränität gegen Zeitläufte zu gewinnen. Jedes Bewusstsein arbeitet mit Zeitschleusen, in denen subjektfremde Zeiten in subjektive Zeitgestalten umgeformt werden müssen. Ständig listen wir fremden Zeitrhythmen kostbare Eigenzeit ab, versuchen zu synchronisieren, was wir als Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen wahrnehmen. Wie weit reicht unsere Zeitsouveränität? Noch gibt es keine Antizeitguerilla, keine Anarchisten fröhlicher Anachronie - trotz der österreichischen Gesellschaft zur Verzögerung der Zeit. Noch steht eine Kultur der Langsamkeit aus, die sich gegen vorauseilende Zukunft und nacheilende Vergangheit wehrt. Zwar revoltiert Momo gegen die Zeitdiebe, der Polarforscher Franklin entdeckt die Langsamkeit, aber das sind literarische Fantasien, denen noch keine selbstgewisse Gegenkultur des Müßiggangs entsprungen ist. Auch der Flaneur Baudelaire, der sich den Schritt von einer Schildkröte vorgeben ließ, blieb Episode, ästhetischer spleen. Mag er auch Zenons widerlegtem Paradox von "Achilles und der Schildkröte" metaphorisch vertraut haben, war das doch harmlos gegen Georg Büchners uneingelöster Primärfantasie der Zeitvernichtung. Der hat schon vor dem modernen Zeitjoch Leonce die Zeit ex-terminieren lassen: "Wir lassen alle Uhren zerschlagen, alle Kalender verbieten und zählen Stunden und Monden nur nach der Blumenuhr, nur nach Blüte und Frucht. Und dann umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt, und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinaufdestillieren, und das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeer stecken." Valerio: "Und ich werde Staatsminister, und es wird ein Dekret erlassen, dass, wer sich Schwielen in die Hände schafft, unter Kuratel gestellt wird; dass, wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist; dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird; und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Makkaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine commode Religion." Gegen die aufdringliche Zukunft kämpfte auch Gontscharows Faulenzer Oblomow, der seinem Schöpfer keinen klassischen Leib abverlangte, sondern seine Fleisch gewordene Gemächlichkeit dem zivilisatorischen Zeitdruck entgegenhielt. Thoureaus Ökofreak Walden verweigerte sich den Zeitläuften im Rückwärtsgang zum einfachen Leben. Viele Aussteiger folgten, um ganz entspannt im "Hier und Jetzt" dem Zivilisationstempo in Landkommunen und Ashrams zu entkommen. Im wieder erwachten "carpe diem" pflückten Blumenkinder, Hippies, Freaks den Augenblick wie eine immerreife Frucht am Baum der Zeit: Live strong, die young. Der buddhistischen Erfahrung totaler Gegenwart wurde mit psychedelischen Mitteln auf die Sprünge geholfen, bis sich erwies, dass diese Gegenwärtigkeit des Erlebens die Wirklichkeit auf der Strecke ließ. Dreißig Jahre später verklärt sich dieser Kult des Jetzt der Gegenwart als Nostalgie...ein Lebensgefühl, das indes die Techno-Generation nicht mehr atmet, weil sie den gesellschaftlichen Beschleunigungsrausch mit noch höherem Tempo zu überholen, d.h. zu übertäuben versucht. Deutlich wird, dass es keinen Königsweg subjektiver Zeitherrschaft gibt, sondern nur verschiedene Reaktionen, Rückläufe, Revolten und Revolutionen zu verlorenen Ursprüngen. Zumindest die alten Justierungen von Reaktion und Progression sind nicht länger tauglich, Gesellschaften politisch zu markieren. Denn wer zurückschreitet, mag seine Zeitsouveränität für die Zukunft gewinnen, während eilige Mitläufer auf der Überholspur der Gegenwart fremder Zeitherrschaft erliegen. b. Zeitsouveränität als Lebenskunst "Wie lebt man also?" lautet zuletzt die kategorische Frage, auf die kein eilfertiger Imperativ "Gehen sie mit der Zeit!" mehr kategorisch antworten wollte. Philosophie der Zeitsouveränität kann nur an die besseren Restposten abendländischer Zeittechniken anknüpfen, um das fruchtbar werden zu lassen, was nach den Erschütterungen von Eigenzeit und ihren Zyklen übrig geblieben ist. In diesem Eigenzeitbeharrungsvermögen gegenüber einer rasenden Gegenwart, die immer schon Zukunft sein will, werden alte Lebenskonzepte wiederbelebbar, die sich schon je einer simplen Fortschrittslogik widersetzten und dem späteuropäischen Bewusstsein zwar keine Zeittranszendenz gewähren, aber eine relative Zeitsouveränität, die das Leben lebbar macht. Alte Strategien der Identität gegen die bedrohliche Zeit - Muße, Maß, Gelassenheit, aber auch Ironie und Eigensinn - können wieder entdeckt werden. Gegen die in einer Lebenszeit uneinlösbare "promesse de bonheur" werden Zeittechniken unabdingbar, mit Leid und Leidenschaften, Zufall und Kontingenz, Alter, Krankheit und Tod umzugehen. Vergessen wir nicht "purpurne Stunden" (Oscar Wilde), ewige Augenblicke und dionysische Lüste, die untrennbar den Fährnissen der Existenz verbunden bleiben. Zeitsouveränität bescheidet sich darin nicht in der Selbstvergessenheit der Gegenwartsflucht, sondern vermittelt die Zeiten von Individuum und Gesellschaft zu einem (mikro)politischen Entwurf des Selbst aus dem Geist anderer Zeitmaße. Vielleicht erscheint dann auf der Bühne des menschlichen Katastrophentheaters ein neues Subjekt olympischer Gelassenheit - mit sich trotz seiner Widersprüche identisch, ein Wahrnehmungsfeld gesellschaftlicher Zeiten, ohne auf subjektive Präsenz zu verzichten. So wird man erst wieder relativ zeitautonom, wenn man begreift, dass sich jede Lebenszeit an den Heteronomien fremder Zeitherrschaft stößt. Der spätaufgeklärte Lebensstil kann auf die diffuse Verzeitlichung der Verhältnisse nur mit verstärkter Selbstreferenz antworten. Nicht zuvörderst auf den hypertrophen Bildschirmen der "Welt da draußen", sondern auf den inneren Monitoren werden Zeitbilder geformt. Wer mit zyklischer Zeitdisziplin auf eine Gegenwart reagieren kann, die heute schon von morgen sein will und übermorgen bereits antiquiert ist, befreit seine Zukunft für morgen - und mag das Übermorgen ruhen lassen. Mit anderen Worten: "du hast wenig Zeit, also nutze sie, ohne ihr hinterherzulaufen." Dabei gibt es keinen schlichten Gegensatz zwischen medialer Beschleunigungssucht und subjektiver Gegenwärtigkeit. Erst in der Erkenntnis medialer Zeitstrukturen, in der beobachteten Pluralisierung der Zeitbegriffe lassen sich subjektive Eigenzeitmodelle inszenieren, die sich nicht den Vorwurf von Weltvergessenheit einhandeln. Zeiträson, Zeitdruck von unten auf die rasende Weltgesellschaft werden gegenüber den Provokationen einer aus den Fugen der klassischen Zeitmodi geratenen Welt notwendig. Das Subjekt muss also zeigen, ob es den Anfechtungen seiner Lebenszeit überlegen ist und auch mit Zeitläuften fertig wird, die seine raumzeitlichen Bindungen unendlich provozieren - der Körperpolitik Boltzmanns folgend: "Ich befinde mich nicht in Bewegung; ob ich stillstehe oder ob ich gehe, mein Leib ist das Zentrum..." IV. Epilog Nicht wäre also die Vergangenheit von der Zukunft zu befreien, sondern die Vergangenheit als Teil der Gegenwart, die die Zukunft bewahrt, zu verstehen. Noch weniger ist die Zukunft von der Vergangenheit zu befreien, weil wir uns die Vergangenheit zu teuer erkauft haben, um sie ungeschehen sein zu lassen. Plädieren wir für eine zeitoffene Gegenwart, die sich gleichermaßen Zukunft wie Vergangenheit solidarisch verbunden weiß - bis dass der Tod uns von der Zeit scheidet. Wir, Zeitherrscher und Zeitknechte, noch weit entfernt davon, Alpha und Omega zu sein, besitzen Zukunft und Vergangenheit nur in kurzer Gegenwart. Mögen wir erinnern, dass wir unsere Zeit sind. Handeln wird auf menschliches Tempo zurückgeschraubt, wenn sich die Zeiten in der Gegenwart zu einem Wissen und Gewissen verschränken, dass wir jetzt leben - in unserer Vergangenheit und für eine kurze Zukunft. Wir sind weder die Heiligen der letzten Tage noch die Götter der Zukunft. Möge Ludwig Wittgenstein nicht für unsere Zeit gesagt haben: "Eine Zeit missversteht die andere; und eine kleine Zeit missversteht alle anderen in ihrer eigenen hässlichen Weise." Mögen wir indes eine kleine Zeit sein, die sich den Luxus leistet, die Leimruten der großen Versprechungen gegen eine gewitztere Wahrnehmung der Gegenwart einzutauschen. Sollte es einen jüngsten Tag geben, werden wir mehr erfahren...wenn die Zeit sich dann selbst erkennt, taucht sie aus der Zeit auf - dann ist ihr Ende gekommen. Diesen locus solus intemporalis gibt es noch nicht, unsere Eingriffe in die vergangene und zukünftige Geschichte bleiben Geschichte. Goedart Palm |
Die Filmstiftung NRW setzt auf "Tempo-Limit"Beim 8. Hörspielforum NRW in Köln geht es um Beschleunigung und Geschwindigkeit und um die Rasanz gesellschaftlicher Veränderungen"Immer schneller, immer weiter" – die Gesellschaft verändert sich in raschem Tempo, und zugleich sind verschiedenste Bereiche aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst einer entsprechend rasanten Entwicklung unterworfen. Diesem Phänomen des Umbruchs und der immer schnelleren Veränderungen kann sich auch das Hörspiel, wie andere Gattungen auch, nicht entziehen; deshalb widmet die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen ihr 8. Hörspielforum NRW dem Thema "Tempo". Vom 27. bis 29. September diskutieren unter dem Motto "Tempo/Limit" Hörspielmacher im Funkhaus Wallrafplatz des WDR in Köln über Beschleunigung in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen und ihre Konsequenzen in Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Für ihr Hörspielforum NRW 2001 konnte die Filmstiftung NRW renommierte Experten in Sachen Geschwindigkeit und Beschleunigung gewinnen, die sich dem Thema praktisch und theoretisch verschrieben haben:
Die 50 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind nicht nur Zuhörer der Referate – für die sich entgegen des Leitmottos ausreichend Zeit genommen wird - sondern werden auch selbst aktiv. In fünf Arbeitsgruppen werden eigenen Produktionen diskutiert, kreatives Schreiben trainiert, mit Internetradio experimentiert und praktische Studioarbeit geübt. |
a< Dr. Palm