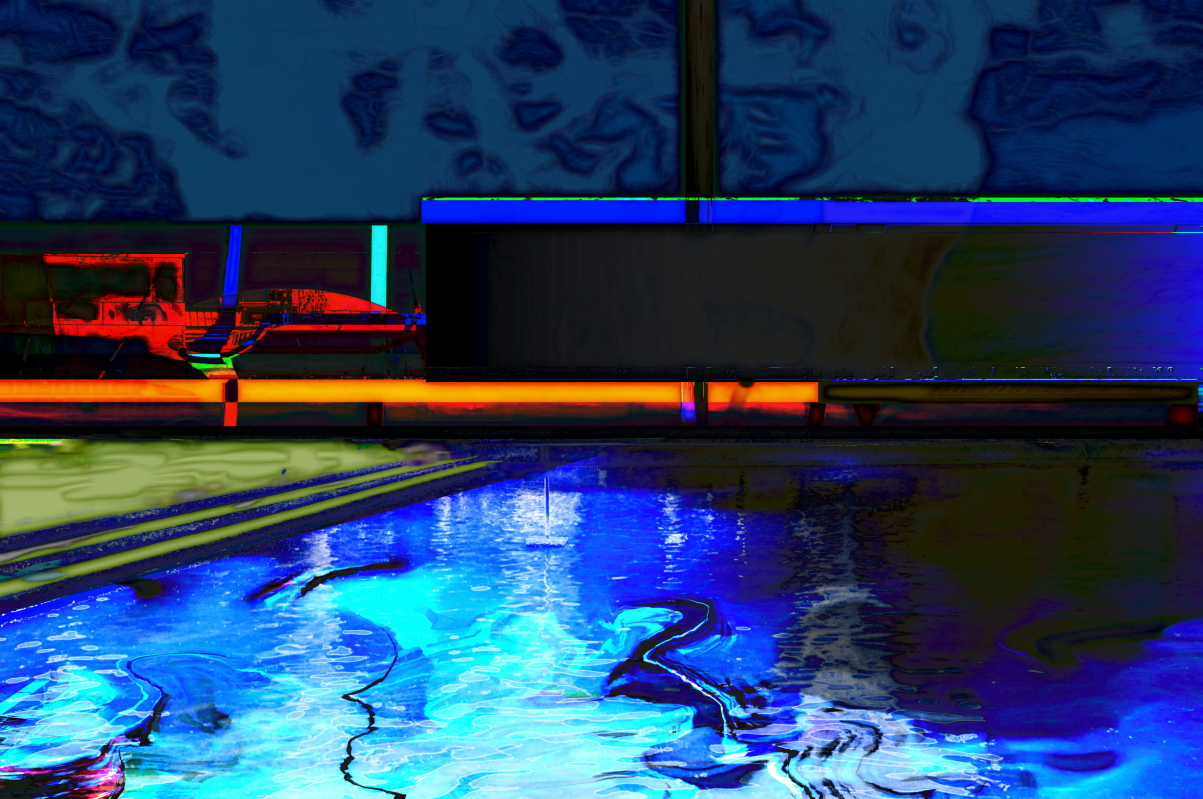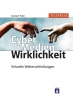|
|
Wilhelm Schmid
Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung.
Frankfurt/M., Suhrkamp 1998 - 566 Seiten 29,90 DM, ISBN: 3-518-28985-3 (zur Zeit 5. Auflage)
Wilhelm Schmids Grundlegung der Existenz in den Zeiten der Katastrophe |
| "Wie kommt es, dass die Zeit die Heiterkeit (gaieté) verloren hat? Das hat seine Ursache in der außerordentlichen Vermehrung unserer Kenntnisse. Mit der Aufklärungswut fanden wir mehr Leere als Völle - und im Grunde wissen wir, dass unendlich viele Dinge, die unsere Väter für Wahrheiten hielten, keine sind, und wir wissen sehr wenig Wahres, das unsere Väter nicht auch schon wussten. Die Leere in unserer Seele und unsere Fantasie - sie ist die wahre Ursache der blasierten Traurigkeit." (Abbé Galiani) |
"Just what is it that makes today´s homes so different, so appealing?" lautete die Frage von Richard Hamiltons frühe Popcollage zu den Lebensentwürfen der Warenwirklichkeit, die keine wahre Wirklichkeit mehr kennt. Nicht nur in den medialen Schlinggewächsen von Fernsehen, Werbung und instantanem Wissen sind die Grundfesten der Existenz in gefährliche Wallung geraten. Wurde das vormals so selbstgewisse Subjekt der Aufklärung in der Entzauberung der Werte, in der Dialektik der Aufklärung in seinem aufrechten Gang verunsichert, stolpern wir, haltlose Zeitgenossen, in der Beschleunigung einer digital vernetzten, virtuellen und katastrophischen Weltgesellschaft in immer neue Fallen unseres fragilen Weltverhältnisses. Die müden Zeitgeister reagieren mit "Anything goes", der lakonischen Blankovollmacht in Philosophie, Kunst, Wissenschaft, aber auch für die zeitgenössische Existenz in allen übrigen Fassetten. Zugleich gilt das Paradox, dass oft gar nichts mehr geht, weil der Freihandel der Wahrheiten und Werte das Subjekt orientierungslos flottieren lässt. "Wie lebt man also?" lautet die kategorische Frage der späten Moderne, auf die kein eilfertiger Imperativ mehr kategorisch antworten will. Der Berliner Philosoph Wilhelm Schmid befragt die Philosophie, die sich nicht länger hinter ihrem Kathederwissen für müßige Peripatetiker verschanzen kann, wenn sie eine Existenzberechtigung für den rasenden Zeitgenossen nachweisen will. Wir vertrauen nicht länger auf behäbige Systemwelten, die das Wirkliche als das Vernünftige ausgaben, noch weniger auf negative Dialektiken, die dem Bestehenden quittierten, die falschen Verhältnisse zu sein. Es mag kein richtiges Leben im falschen geben, aber es gibt kein anderes. Die philosophische Anstrengung Schmids zielt darauf, ein anderes Denken und demgemäß gewitztere Seinsweisen zu entwickeln - Philosophie, Kunst und Alltagsleben verschränkend, immer eingedenk der unbequemen Einsicht Nietzsches, dass man zu Grunde geht, wenn man zu den Gründen geht. Schmids Philosophie der Lebenskunst knüpft an die besseren Restposten der abendländischen Philosophie an, um das fruchtbar werden zu lassen, was nach der Demontage der Werte, der Wahrheit und damit der Philosophie selbst übrig geblieben ist. Und Schmid zeigt, dass das alles andere als eine postmoderne Konkursmasse ist, die zur Befriedigung der ungläubigen Gläubiger nicht mehr ausreicht. In Fortführung seiner bisherigen Abhandlungen mobilisiert er in einem gewaltigen Parcours antike Lebensphilosophien, die essayistischen Selbstentwürfe Montaignes, die lebensphilosophische Neubestimmung der Hermeneutik durch Dilthey, Foucaults Macht-Lust-Diskurs, aber auch die quälenden Aporien der Moderne, die noch immer einer Antwort harren. Längst sind in der ökologischen Drohgestalt der Erde, der gentechnologischen Manipulierbarkeit von Mensch und Natur, der Virtualisierung von Raum und Zeit Phänomene der Weltveränderung aufgetreten, die noch radikaler in die menschliche Konstitution eingreifen, als es klassische Angriffe auf die menschliche Zentralperspektive vermochten. In der Ästhetik der Existenz werden prämoderne und "andersmoderne" Techniken der Sorge um sich selbst, Ironie, Maß, Muße, Gelassenheit wieder entdeckt. Schmids philosophische Grundlegung der Lebenskunst will gleichwohl alles andere als das Vademecum eines glücklicheren Lebens sein. Nicht nur Kant und Foucault hegten wohlbegründete Zweifel gegenüber dem Glückseligkeitsanspruch der menschlichen Existenz. Gegen die uneingelöste "promesse de bonheur" werden Techniken unabdingbar, mit Leid und Leidenschaften, Zufall und Kontingenz, Alter, Krankheit und Tod umzugehen. Aber wir wissen auch um "purpurne Stunden" (Oscar Wilde), ewige Augenblicke, dionysische Lüste, die untrennbar den Fährnissen der Existenz verbunden sind. So bleiben die Grunderfahrungen menschlicher Existenz der Reflektionsstoff praktischer Philosophie, neu aber sind die Gestalten der Katastrophen, der unübersichtlich gewordene Zusammenhang von individuellen und kollektiven Heils- sowie Unheilsgeschichten. Philosophie der Lebenskunst bescheidet sich nicht in der Selbstvergessenheit der Weltflucht, sondern avanciert zum selbstkritischen Vermittlungsmodus von Individuum und Gesellschaft, zu einer politischen Veranstaltung des Selbst aus dem Geist des Anderen. Auf der Bühne des menschlichen Katastrophentheaters erscheint somit der Vorschein eines neuen Selbst - mit sich trotz seiner Widersprüche identisch, ein Durchzugsfeld gesellschaftlicher Energien, eine polyfone Stimmung, die gleichwohl nicht auf Kohärenz verzichtet. Kein Subjekt einer wohlversicherten Identität, sondern eine multiple, aber gesunde Persönlichkeit gilt es zu entwerfen. Keine transzendente Rückversicherung, sondern eine ethisch-asketische, säkulare Seinsweise ist zu entwickeln, die sich gleichwohl den Luxus gestatten kann, lustvoll, aber auch gleichmütig zu sein. Wer wissen will, wie in der Spätmoderne gelebt werden kann, wird seine eigene Existenz als nichtarchimedisches Experiment begreifen, wird seine Gewohnheiten immer wieder auf den Prüfstand schicken und auf ihnen wie auf einer Klaviatur des besseren Lebens spielen. Schmid zeigt, dass alte Frontstellungen der Philosophie, Selbst und Anderer, Identität und Entfremdung, Individuum und Gesellschaft, kollabieren. Auch wenn nichts mehr verlässlich ist, heißt das eben nicht, dass der Mensch verlassen wäre. Wir beobachten die Geburt des Selbst aus dem Geist des Anderen, sodass Schmid gegenüber den ausklingenden Eruptionen der Postmoderne, die nur noch ein Gelächter für den abendländischen Rationalismus übrig hatte, eine andere, verantwortlichere Moderne konzipieren kann. Schmid entledigt sich nicht, wie etwa die Denker des posthistoire, der Errungenschaften der Aufklärung, sondern plädiert für eine zweite Aufklärung, die über sich selbst aufgeklärt ist und sich von dem Glauben an die totale Rationalisierbarkeit der Lebens- und Gesellschaftsentwürfe befreit. So kann man erst wieder autonom werden, wenn man begreift, dass Autonomie den Untiefen des Lebens unterworfen bleibt. Aber nicht auf den hypertrophen Bildschirmen der "Welt da draußen", sondern auf den inneren Monitoren werden die Bilder geformt, die die Welt bestimmen. Sorge um sich selbst heißt nicht erst seit heute Sorge um den Anderen, Sorge um die Weltgesellschaft, weil ab jetzt kein Sein mehr behaupten kann, von dem anderen unabhängig zu sein. Weder das kollektivierte Individuum der Massengesellschaft, die sich spätestens im Internet mit unübersichtlichen Sender-Empfänger-Verhältnissen auflöst, noch die klassische Staatsräson im Vertrauen auf die gute Politik können uns als Remedien gegen die "katastro-phile" Verfassung der Welt dienen. Menschheitsräson, Druck von unten auf die Weltgesellschaft werden gegenüber den Provokationen einer aus den Fugen geratenen Zeit notwendig. In dieser Horizonterweiterung, aufgezwungen durch eine rasende Gegenwart, die immer schon Zukunft sein will, werden antike und prämoderne Lebenskonzepte wiederbelebbar, weil sie sich schon je einer simplen Fortschrittslogik widersetzten und den (Selbst)Gewissheitsverlusten des späteuropäischen Bewusstseins zwar nicht seine vormals transzendentale Sicherheit zurückgeben können, aber die relative Autonomie, die das Leben lebbar macht. Mit Schmid müssen wir uns zumindest von alten Gegensätzen trennen, weder Subjekt noch Objekt, Sosein und Anderssein, Wirklichkeit und Virtualität bewahren ihre klassische Form. Das Subjekt muss zeigen, ob es seiner trägen Stammesgeschichte überlegen ist und die Lebenskunst, die eine Kunst des Selbst ist, auch mit den Anforderungen fertig wird, die seine raumzeitliche Geworfenheit unendlich provozieren. Die Lektüre der wichtigen Untersuchung von Schmid und ihre lebenspraktische Fortführung durch den Leser mag dann die Haltegriffe schaffen, seine eigene Existenz immer wieder der Kritik und Rekonstruktion zu unterziehen und sich in klügerer Weise auf ein Spiel einzulassen, das Leben heißt. Dr. Goedart Palm |