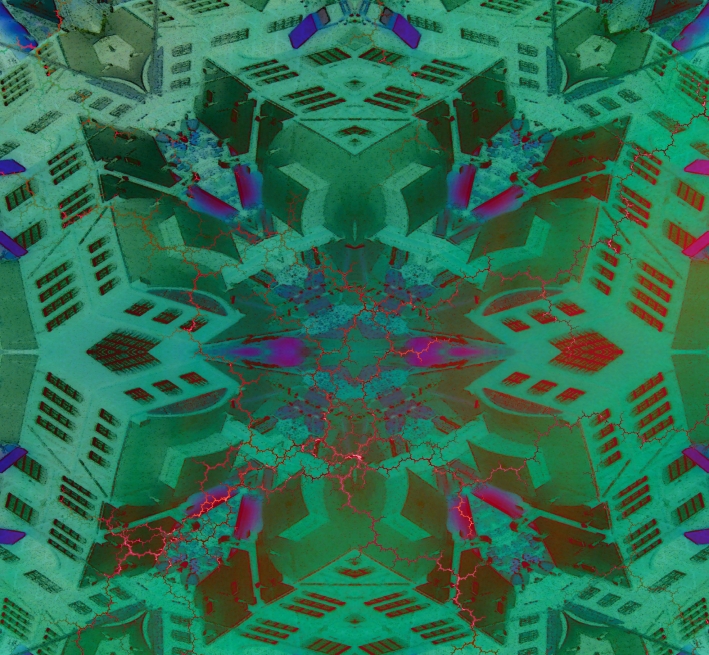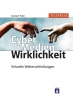|
Gesellschaftlicher Medienterror wird seit längerem als
Äquivalent demokratischer Persönlichkeiten umgemünzt. Die mediale Grundversorgung des
zoon politikon veränderte sich zur richtungslosen Überrüstung politischer
Partizipation. Die virtuelle Persönlichkeit führt uns weder zu den demokratischen
Blütenträumen der Parteitagsprogramme noch in ein freigewähltes Exil der
Selbstbescheidung. Am Textrand bemerkt: Herrschaftsfrei ist dieser entfesselte Text
zuletzt, pure Macht ballt sich zusammen und wird alles verdrängen, was außerhalb liegt.
Sozialpsychologisch betrachtet garantiert das Netz keine Solidargemeinschaften seiner
Bewohner. Telesolidarität ist eine fragile Kategorie, da der sinnliche Zusammenhang von
Menschen für den Netzbewohner die reale Ausnahme von der virtuellen Regel darstellt. Der
soziale Autismus des klassischen Medienusers wird auch über die Interaktivität nicht
aufgehoben, sondern bleibt ein typischer Habitus des "Monitoring", des
Bildschirmlesens.
Stammesgeschichtliche Prägungen lasten auf den alten Köpfen, die keine Chance haben,
ihrer "wetware" ein saisonal frisches "update" per mouseclick zu verpassen, wie es
für software selbstverständlich ist. Die bedingte Konstruktion unseres Bewusstseins ist
die Konstruktion der kleinen Welt, die wir aus dem großen Netztext herausschneiden. Auf
diesen kleinen Texten, die dem Netztext abgerungen sind, lastet aber die immer währende
Hypothek, dass sie schon im Entstehungszeitpunkt antiquiert sind, weil sich der große
Muttertext, die Matrix des Weltwissen, fortspinnt. Die stammesgeschichtlichen
Voraussetzungen des Gehirns binden jede Erkenntnis zunächst an die Lösung praktischer
Probleme. Die Kausalität zwischen Magie und erfolgreicher Lebenspraxis war dem
archaischen Bewusstsein selbstverständlich.
Ockham's razor hatte zur Zeit des Faustkeils noch keine Schärfe. Der
kartesianisch-rationalistische Zugriff auf die Netzwelt ist eine Magie anderer Ebene. Wie
jede ordentliche Magie löst sie gewaltige Probleme. So können Netzapologeten auf die
funktionalen Zugewinne in der Praxis sämtlicher Lebensbereiche verweisen. Es ist Magie,
weil dem Netz Zwecke entnommen werden, die auf den Leisten menschlicher Belange gelegt
werden, ohne mit Zwecken zu rechnen, die die Funktionalität menschlicher Praxis
verlassen. Es ist Magie, weil jede Remedur des Netzes - schneller! besser! umfassender! -
durch gegenläufige Energien durchkreuzt wird. Wie soll sonst erklärt werden, wie
digitale Viren auftreten? Wie soll sonst erklärt werden, dass die kollektive
Beschleunigung den Einzelnen permanent verlangsamt? Die Ablösung der kartesianischen
Altmagie, die uns das Netz erklären will, steht noch bevor. Das schwarze Loch, in das sie
kollabiert, kann nur erahnt werden. Sicher aber sind Bedenken gerechtfertigt, ob sich
binäre Logik, Diskursivität und die anderen Errungenschaften des homo sapiens sapiens
als Endpunkte des Netztextes aufrechterhalten lassen. In der Komposition einer
produktionswütigen Schöpfung, die zugleich wie ein großer Müllschlucker alle ihre
Kinder frisst, ist das Individuum die kläglich-heroische Variante eines alteuropäischen
Themas, das jetzt im Netzkollektiv beendet wird. Marshall McLuhan im Anblick der fossilen
Massenmedien vom Untergang des Individuums menetekelte, lässt sich heute ungleich
substantiierter diese Entwicklung wahrnehmen. Netzbewohner speisen sich als Zeichen in das
autopoietische Netzgesamtkunstwerk ein: Wie kleine Textpartikel fügen sie sich in den
Hypertext ein, bilden Wörter, Sätze, Diskurse etc. Zum Ebenbild des Allmächtigen haben
sich die Menschen zu allen Zeiten vermessen. Doch heute schiebt sich der babylonische
Turm, den die Netzmetapher ersetzen mag, zur Wirklichkeit empor, ohne in der Hybris des
Menschen einzustürzen. Diesmal stellen wir es klüger an, mit Netz und doppeltem Boden.
Die Selbstbescheidung des Menschentiers auf seine Ursprünge, das "Zurück zur
Natur", die Holzwege ins einfache Leben, zu den Wiesengründen der frommen
Denkungsart sind verstellt. Der Stil im Leben wie im Text, die alte Zauberformel des
Individuums, liegt durchschossen von den digitalen "strings and arrows of outrageous
fortune" darnieder. Apokalyptische Zustände gedeihen im Netztext einer rasenden
Geschichte, von der keiner behaupten soll, es wäre unsere. Dabei ist es noch die
durchsichtigste Ironie des Netzes zu suggerieren, die Nutzer wären Nutznießer, die
Navigatoren Kapitäne.
INFORMATIONSTERROR begegnet den kurzgeratenen Netzriesen, die in das gigantische
Fadenkreuz globaler Erscheinungen geraten. Die klassische Scheidung zwischen
Öffentlichkeit und Privatheit wird weggespült. In der allpräsenten Diskussion des
Datenschutzes und der Vervielfachung der Sender, der Auflösung der klassischen
Nachrichteninstrumente, zeigt sich die Brüchigkeit dieser Sphären. Diskurs- und
Meinungszwänge gegenüber dem wuchernden Welttext lässt die überforderten
Weltinformationsunterworfenen zwischen Euphorie und Apathie pendeln, mindestens aber
reicht es zur Erfahrung struktureller Informationsmacht. Heute erleben wir die Aporien der
ubiquitären Vernetzung jedes Menschen mit der angeschlagenen Totalbefindlichkeit dieser
Welt. Das Individuum wird zum Monitor von Lektüren, deren Existenz gestern nicht mal
geahnt wurde.
Goedart Palm
Die
Zukunft des Internet, Essay bei telepolis zum zehnjährigen Jubiläum
Goedart Palm jetzt auch unter Glanz und Elend zu
finden |