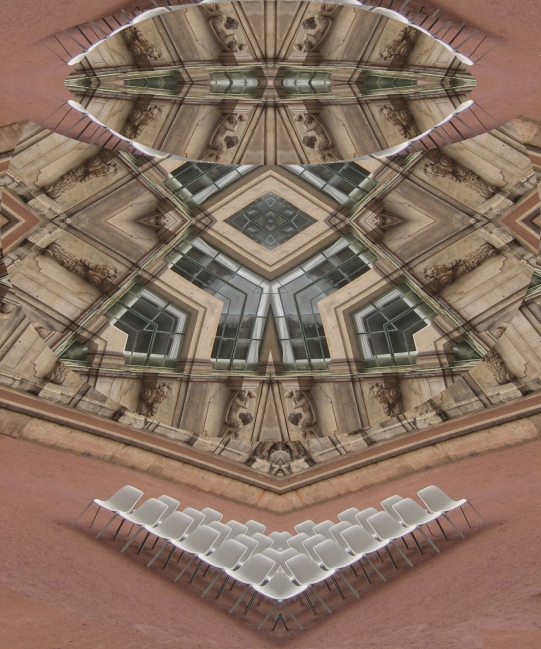|
|
Zur "Demokratisierung" des Festspielhauses
|
Kunst und Demokratie sollten in den siebziger
Jahren zusammenkommen. Wenn eine Gesellschaft mehr Demokratie wagen
sollte, wieso sollte das nicht auch für die "Kunst" gelten?
Schnell differenzierte sich dieser Diskurs: Eine Mitbestimmung in künstlerischen
Angelegenheiten sei nicht akzeptabel. Der Künstler müsse in seinen künstlerischen
Entscheidungen frei sein. Doch Rahmenbedingungen künstlerischer Praxis
seien demokratiefähig. Diese einfache Dichotomie harmonisierte nicht
alle Probleme. Wie sieht Mitbestimmung in der Oper aus? Lassen sich hier
oder im Theater künstlerische und nichtkünstlerische Inhalte gut
trennen? Diese Verbindungslinie zwischen Kunst und Demokratie blieb
fragil und war kaum je geeignet, notwendige oder auch nur plausible
Entscheidungen zu begründen. Die Diskussion um das Bonner Festspielhaus
"Beethoven" ist nun auch an diesen Punkt gelangt. Eine
Volksabstimmung über Bau oder Nichtbau soll die Frage sein. Ob es nicht
edler im Gemüt wäre, künstlerische Kriterien gegen eine Mehrheit zu
verteidigen, brauchen wir also gegenwärtig nicht mehr zu entscheiden.
Die Abstimmung über den Musentempel quadriert den erlauchten Zirkel.
Denn die dort repräsentierte Kultur ist die eines kleinen Kreises, den
dieser Kreis freilich aus mehr oder weniger beachtlichen Gründen
erweitern möchte. Würden Mehrheitsargumente oder Bedarfskriterien zählen,
wäre historisch nicht viel Kultur entstanden. Vermutlich hätten sich
Sklaven nicht zum Bau der Pyramiden bewegen lassen. Aus diesem Argument
ist weder für die gegenwärtige Existenz der Pyramiden noch für die
Frage, ob man noch mehr Kultur produzieren soll, wenn die Grundbedürfnisse
anderer Menschen unbefriedigt bleiben, viel zu gewinnen. Kultur ist
Luxus, was sich nicht erst im Blick auf das globale Chaos von Not und
Armut erhellt. Insofern sind Kulturausgaben regelmäßig mit moralischen
Hypotheken belastet, was den Genuss des kulturbeflissenen Publikums
differenzieren sollte. Andererseits hilft Kultur vielleicht bei der
Besserung und Erziehung des Menschengeschlechts, sodass auf sehr
indirekten Wegen die Kultur doch ihre eigene Art von Notwendigkeit
behaupten darf. Statt
allerdings diese schwer bis nicht entscheidbaren Fragen nach der
kulturellen Fundierung von Gesellschaften zu wälzen, könnte man hier
schlicht nach möglichen Verlaufsformen und Effekten der Abstimmung
fragen. "Die Bürgerschaft einbeziehen - Wichtig ist, dass die Bürgerinnen
und Bürger auch weiterhin auf dem Weg hin zur Realisierung
„mitgenommen“ werden. Dieses wird nur dann erfolgreich, wenn die Bürgerschaft
es auch akzeptiert und sich beteiligt fühlt", heißt es auf der
Website von Markus Schuck, des Obmanns der CDU-Ratsfraktion im
Kulturausschuss. Das ist einvernehmlich und konsensorientiert
formuliert, doch die Schräglage einer solchen Mitbestimmung wird hier
ausgeblendet. Einem größeren Teil der Bürger dürften Existenz oder
Nichtexistenz eines Festspielhauses keine Nachfrage wert sein. Wenn es
gelingt, breite Kreise überhaupt zu einer Reaktion zu bewegen, wird die
Abstimmung negativ ausfallen. Wer wenig Geld in der Tasche hat, hat wohl
kaum Sympathie für Kulturprojekte, an denen er letztlich eher nicht
partizipieren wird. Klassik hat, von einigen Prestigeveranstaltungen
abgesehen, nur eine kleine Fangemeinde. Warum keine Rock-Arena? Warum
kein Sport-Stadion? Wer wie Nimptsch demokratisieren will, gerät in
diesen Begründungsregress. Einige
vertrauen auf die Gunst der Bürger, weil die diversen Beteiligten
versichern, dass die Stadt Bonn keinen Cent für das fürstliche Haus
zahlen wird. Hier wird mal wieder die Zukunft antizipiert. Kostenfallen
existieren, wie es unzählige Bauprojekte demonstrieren, zahlreich. Im
Übrigen ist das Argument, dass das Festspielhaus nichts kostet, auch
kein Plädoyer für die Kunst, sondern eine bloße Beschwichtigung. Ein
echtes Bekenntnis zu Kunst und Kultur sieht völlig anders aus. Wenn der
Bürger nach sachlichen Kriterien entscheiden soll, dürfte die
Beteiligung an der demokratischen Kultur auch nicht weit reichen.
"Wie viel Festspielhaus hätten Sie denn gern", führt uns zu
der Frage zurück, wie viele Pyramiden kulturell wünschbar sind. Denn
wenn auch notwendige Kapazitäten der Kultur beschworen werden, lässt
sich im Zeitalter der virtuellen Reproduzierbarkeit per Internet und
Silberscheibe daraus kein überzeugendes Argument gewinnen. Vermutlich lässt
sich das Festspielhaus argumentativ überhaupt nicht rechtfertigen: Man
macht es oder lässt es. Der Rest ist Palaver. Denn welche Entscheidung
man auf welchem Wege, plebiszitär, kommunalparlamentarisch oder
verwaltungsbürokratisch, auch trifft, ändert doch nichts an der
Konsequenz, dass irgendwer hinterher immer weiß, dass man es hätte
anders machen müssen. Die Diskussion um das Festspielhaus ist gefährdet,
sich zu einer Farce zu entwickeln, weil die Qual der Entscheidung nun
durch Eiertänze ersetzt wird, denen nicht abzulesen ist, ob es sich
bereits um Absetzbewegungen einiger vormals Entschlossener handelt oder
kulturelle Zahnlosigkeit. Kultureller Enthusiasmus sieht jedenfalls
anders aus. Zum Bild einer administrativ zähen Kulturpolitik passt die
gegenwärtige Entwicklung indes schon - mit oder ohne Abstimmung. Dr.
Goedart Palm |
|
Dekonstruktive Fantasie |
Vor- und Nachschläge für Bonn: Beethoven Exil - Bonner Bergwelten - Bonn Drops - Bonn Klassik - Bonn Waterworld - Denkmaltausch - Funtastic - Future Views - Hafenrundfahrt Beethoven - Hambeuel - Ideenwettbewerb - Old Postcards - Queue Gardens - Palmen für Bonn - Pop up Dorf - WCCB